| KULTURATION | Online Journal für Kultur, Wissenschaft und Politik Nr. 24 • 2021 • Jg. 44 [19] • ISSN 1610-8329 | Herausgeberin: Kulturinitiative 89 | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| Thema | Kulturation 2/2005 |
| Kulturelle Differenzierungen der deutschen Gesellschaft | |
| Redaktion | |
| Zweite Enquête unter Kulturwissenschaftlern und Kulturpolitikern zum kulturellen Wandel in Deutschland | |
| Zweite
Enquête unter Kulturwissenschaftlern und Kulturpolitikern zum
kulturellen Wandel in Deutschland als Folge des Beitritts der DDR zur
Bundesrepublik
1993/94 veranstaltete die Redaktion (damals noch der „Mitteilungen aus der kulturwissenschaftlichen Forschung“) eine Umfrage unter Wissenschaftlern und Kulturpolitikern, worin denn nach 1989/90 der kulturelle Wandel in Ostdeutschland bestehe. Die damaligen Antworten sind in unserer Rubrik Zeitdokumente zu finden. Der fünfzehnte Jahrestag des Beitritts der DDR zur Bundesrepublik Deutschland ist ein Anlass, die kulturellen Folgen der deutschen Einheit nach gut einem Jahrzehnt erneut zu diskutieren. Wir haben zunächst die damaligen Teilnehmenden gebeten, sich wiederum zu den kulturellen Veränderungen zu äußern, ggf. ihren damaligen Text zu kommentieren oder ihre heutigen Befunde auf andere Weise mitzuteilen. Die erneute Recherche wurde thematisch erweitert und den Mitwirkenden folgender „Fragebogen“ vorgelegt: Erstens: Worin sehen/vermuten Sie im Rückblick auf 15 Jahre deutsche Einheit die wichtigste kulturelle Veränderung in Ostdeutschland? Zweitens: Gab es (auch) in den alten Bundesländern einen kulturellen Wandel? Drittens: Stehen Sie zu Ihrer Auffassung von 1994 …? Viertens: Welchen kulturellen Prozessen sollte künftig unsere Aufmerksamkeit gelten? Wo erkennen Sie wichtige kulturelle Innovationen? Wer sind die produktivsten Szenen, Bereiche, Milieus, sozialen Gruppen in den kommenden Jahren? Fünftens: Kultur ist international zu einem Feld von Auseinandersetzungen geworden, auch von Gefährdungen ist die Rede. Wo sehen Sie in der neuen Situation Chancen und wo Gefahren? Sechstens: Was ist wichtiger als Antworten auf diese Fragen Hier folgen die Transkripte der Interviews von Peter Alheit Max Fuchs Hermann Glaser Albrecht Göschel Volker Gransow Antonia Grunenberg Horst Haase Michael Hofmann Helmut Hanke Wolfgang Kaschuba Thomas Koch Dieter Kramer Alf Lüdtke Jürgen Marten Dieter Rink Kristina Volke Rudolf Woderich Den Abschluss bilden kommentierende Beobachtungen zu den eingegangenen Antworten (von Harald Dehne, Isolde Dietrich, Gerlinde Irmscher und Dietrich Mühlberg). Transkripte der Interviews in alphabetischer Reihenfolge Max Fuchs (23. August 2005) 
Prof. Max Fuchs (Remscheid) im Interview Erstens: Die erste Frage war die nach den wichtigsten kulturellen Veränderungen in Ostdeutschland. Ich würde die gerne zweigeteilt beantworten. Also was die "normalen Menschen" betrifft in Ostdeutschland, ist das einfach der Erwerb der kulturellen Kompetenz mit Kapitalismus umzugehen. Das ist sicherlich nicht bloß die Erkenntnis, dass Geld eine andere Rolle spielt und der Warencharakter dominant ist, sondern das erfordert auch eine ganze Reihe anderer Dispositionen und Mentalitäten, sich daran zu gewöhnen, dass man auch eine andere Rolle spielt in so einem Staatsgebilde. Für den Kulturbereich im engeren Sinn war glaube ich das Schmerzhafteste - und das hat auch meine Antwort vor reichlich 10 Jahren geprägt: dass sich Kultureinrichtungen jetzt auf das neue politische und gesellschaftliche System einstellen mussten. Und das erste Erlebnis war, dass unglaublich große Anzahlen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Kultureinrichtungen waren. Ich kann z. B. eine Zahl benennen. Das FEZ in der Wuhlheide hatte damals versucht, in die Förderung des Kinder- und Jugendplanes des Bundes zu kommen, ein wichtiges jugendpolitisches Förderinstrument. Da gab es Hunderte von Mitarbeitern und der Finanzbedarf dieses FEZ alleine wäre, ich glaube, alleine zweimal so groß gewesen wie der gesamte Haushaltstitel für die gesamte Kinder und Jugendkulturarbeit, die auf Bundesebene damals in Westdeutschland gefördert worden ist. Da war einfach völlig klar, dass diese große Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Kulturbereich in dieser Form überhaupt nicht finanzierbar sein wird. Und das zu vermitteln, war damals meine Aufgabe und darauf hat sich der Kulturbereich in Ostdeutschland einstellen müssen, sodass ich glaube, dass es eine ganz entscheidende Veränderung für die Menschen war, die im Kulturbetrieb arbeiteten. Zweitens: Die zweite Frage nach dem kulturellen Wandel in Westdeutschland. Es wird vielleicht überraschen, aber ich glaube der liegt auf derselben Ebene wie in Ostdeutschland. Zwar gab es natürlich in Westdeutschland schon einige Jahrzehnte ein kapitalistisches System, aber die Forschung zeigt (und auch die Erfahrung), dass es ganz unterschiedliche Formen von Kapitalismus gibt. Man spricht auch von einer Vielfalt kapitalistischer Systeme. In Westdeutschland hatte man unter all den Möglichkeiten, wie Kapitalismus organisiert werden kann, noch so ein sozial verträgliches System, das, was man „Rheinischen Kapitalismus“ nennt oder soziale Marktwirtschaft oder wie all diese Begriffe heißen. Faktum ist aber, dass die soziale Absicherung noch unglaublich stark war, auch im internationalen Vergleich mit vergleichbaren Ländern. Seit Anfang der 90er Jahre begann das, was man heute ja sehr gut kennt, nämlich die Globalisierung. Die ist ja nicht bloß eine Erfindung von Intellektuellen, sondern es gibt einfach eine weltweit vernetzte Wirtschaft - auch natürlich eine weltweit vernetzte Kultur - und diese Globalisierung der Wirtschaft, also die Durchsetzung eines sehr marktliberalen Ordnungssystems, bei dem soziale Absicherungen nur noch stören, das fing so etwa vor zehn Jahren an auch die Westdeutschen zu ergreifen. Und ich glaube, der Mentalitätswandel, zu dem auch solche Dinge wie Hartz IV gehören, wozu ja gehört, so genanntes Anspruchsdenken zu reduzieren, dankbar zu sein für all das, was man überhaupt noch an sozialer Absicherung bekommt, dieser quasi nationale Umerziehungsprozess, der hat in dieser Zeit stattgefunden, sodass ich schon denke, das kapitalistische System heute in Deutschland ist überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit dem System, das die Westdeutschen kennen gelernt haben und an das sich vermutlich die Ostdeutschen auch gerne angeschlossen hätten. Man kann nur noch davon träumen, sodass heute der Kampf darum geht, unter den verschiedenen Varianten kapitalistischer Modelle eben doch noch mal eines zu finden, oder dafür zu kämpfen, das relativ dem, was man „Rheinischen Kapitalismus“ nennt, also sozial stark abgefedert, nahe kommt. Ich denke, das ist auch ein kulturelles Problem, das hat mit Mentalitäten zu tun. Das hat aber auch mit dem Umgang mit der Lebensqualität der Menschen zu tun. Drittens: Die dritte Frage, ob ich zu meiner Auffassung von 1994 stehe, ja das habe ich eben schon angedeutet. Damals war für das Kultursystem der Übergang zu einem härteren Umgang mit Zeit zum Beispiel zu bewerkstelligen. Also wir hatten damals schon mit einer großen Bewunderung - nicht nur im Kulturbereich, sondern das gilt auch für den Wissenschaftsbetrieb - gesehen, dass man im Osten Deutschlands einen vielleicht humaneren Umgang mit Zeit gepflegt hat. Das heißt, diese Hektik war nicht so gegeben, im Wissenschaftsbereich war nicht unbedingt das Prinzip um jeden Preis publizieren zu müssen, sondern man konnte sich doch mit einer sehr viel größeren Gelassenheit auf seine Projekte, auch im Kulturbereich, einlassen. Diese Zeit ist zu Ende gegangen und das war etwas, was man auch zum Beispiel hat sehen können an der Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kulturbereich. Ich kenne jetzt keine präzise Statistik, aber ich glaube, bestenfalls noch ein Zwanzigstel der Leute, die damals beschäftigt waren, sind heute noch im Kulturbereich beschäftigt. Insofern glaube ich, dass das, was ich damals - so als Kassandra - formuliert habe: so wird es kommen - das ist inzwischen eingetreten und ich glaube nicht, dass das eine Entwicklung zum Besseren ist. Aber es ist die Anpassung an den Standard West. Viertens: Frage vier, das sind verschiedenen Fragen. Die Frage nach dem kulturellen Innovationen: da glaube ich, dass möglicherweise die großen Innovationen, auch im Kunstbereich, um mal auf den Bereich von Kultur einzugehen, gar nicht in der Großstadt sind sondern eher in den in den Klein- und Mittelstädten. Also man erlebt das, dass Tanzkompagnien, etwa die in Saarbrücken, vielleicht auch, weil sie nicht ständig in den großen Feuilletons sind und sich irgendwo beweisen müssen, mehr Zeit zum Entwickeln haben und von da her unglaubliche Qualitäten entwickeln. Hier ist die Situation in den neuen Bundesländern - dort gibt es ja nicht die großen Metropolen, sondern das ist eher eine ländliche Struktur oder Struktur von Klein- und Mittelstädten - für diese Prozesse geeignet. Ich will nur an William Forsythe erinnern, der letztes Jahr gewechselt hat von der Metropole Frankfurt am Main in die neuen Bundesländer,auch weil er sich überlegt hat, dass er dort vermutlich bessere Rahmenbedingungen hat zu arbeiten. Und eben habe ich in der Zeitung gelesen, dass er möglicherweise der Choreograf des Jahres werden wird. Also das wäre so etwas. Der Umgang mit Provinz ist, glaube ich, etwas was für Deutschland ziemlich wichtig ist, weil die Provinz dort gar nicht negativ besetzt ist, sondern eher auch auf Grund der Vielfalt, auch der föderalen Struktur, ganz andere Entwicklungsmöglichkeiten hat. Die produktivsten Szenen? Ich komme ja nun aus der Kinder- und Jugendkulturarbeit: Es sind aus meiner Sicht die Kinder und Jugendlichen, die die kulturelle Kompetenz entwickeln, entwickeln können - das sehen wir in der Praxis - selbst in einem kulturindustriell geformten Bereich den Eigensinn ästhetischer Produkte durchzusetzen. Und so denke ich, dass es wichtig ist, sie auch in diesem Feld Kinder- und Jugendkulturarbeit besonders zu berücksichtigen und es ist gut, dass die hohe Kulturpolitik, die großen Kultureinrichtungen, kulturelle Bildung als Pflichtaufgabe zunehmend erkennen und wo sie es nicht erkennen, dass man förderpolitisch nachhilft, dass sie das denn auch tun. Ansonsten ist der vermutlich wichtigste kulturelle Prozess derjenige, dass ein neues Generationenverhältnis entsteht. Das hat ja nicht bloß damit zu tun, dass die älteren und alten Menschen immer mehr werden, sondern dass man bisher überhaupt keine kulturelle Kompetenz hat mit Gesellschaften, in denen es eine solche Altersstruktur gibt. Und dort wird man einfach neu definieren müssen, wie die einzelnen Menschen in der Gesellschaft miteinander umgehen. Das ist ein eminent kulturelles Problem. Es ist natürlich auch ein soziales und ökonomisches, aber es ist eben auch ein kulturelles Problem, dafür Kompetenzen zu entwickeln: wie man die neue Mixtur von Erfahrungen und Erfahrungswissen der verschiedenen Generationen miteinander in Verbindung bringen kann. Fünftens: Die fünfte Frage - Kultur international? Das ist etwas, was uns auch als Kulturrat beschäftigt, Kulturpolitik kann überhaupt nicht mehr national betrieben werden. Das ist die erste Erkenntnis, und die zweite Erkenntnis: Kulturpolitik kann vor allen Dingen nicht mehr als spezialisierte Kulturpolitik betrieben werden. Wir werden gleich die Wahlprüfsteine des Deutschen Kulturrates zu der nächsten Bundestagswahl, die ja vermutlich stattfinden wird - am Donnerstag soll das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung bekannt geben, ob die Wahl denn nun stattfinden darf - die werden wir morgen vorstellen und man wird feststellen, Förderpolitik im engeren Sinne, d. h. zum Beispiel Haushaltsansätze, spielen - mit Ausnahme der auswärtigen Kulturpolitik - überhaupt keine Rolle. Aber eine Rolle spielen internationale Organisationen wie die Welthandelsorganisation oder die Europäische Union. Dort werden Rahmenbedingungen geschaffen, die entscheidend dafür sind, möglicherweise entscheidender als die Frage, ob ein Kulturhaushalt ein bisschen größer oder kleiner ist, wie Kulturarbeit, wie Kunstproduktion, wie kulturelle Bildungsarbeit in Zukunft stattfinden kann. Das sind die wichtigsten Prozesse. Es sind sozusagen Global Players jetzt im Spiel, die hätte man vor zehn Jahren noch gar nicht auf dem Schirm gehabt - die WTO ist 1995 gegründet worden, d. h., die gab es damals noch gar nicht. Und heute meinen viele Kulturakteure, sie müssen sich nicht drum kümmern und es ist auch schwierig zu erklären, was GATS ist und das Inländerprinzip und die Meistbegünstigtenklausel, hier musste die Kulturpolitik dazulernen und muss vermutlich noch sehr viel mehr dazulernen. Ja, dass das alles auch Chancen hat, wenn Kulturen sich begegnen, wenn es denn auch wirklich verschiedene Kulturen sind, deswegen ist es wichtig, für kulturelle Vielfalt sich einzusetzen, so wie es jetzt im Rahmen der UNESCO und der Konvention zur kulturellen Vielfalt auch geschieht. Sechsten: Was ist wichtiger als die Antwort auf diese Fragen? Nun ich habe die Fragen bisher aus meinem Arbeitsschwerpunkt, nämlich Kulturpolitik auf Bundesebene, beantwortet. Kulturpolitik auf Bundesebene hat es weniger mit Künsten direkt zu ist wieder klar geworden, wie wichtig dieses Konzept der Lebenskunst ist, dass nämlich im Mittelpunkt von all den Anstrengungen, auch den politischen, auch den juristischen Rahmenbedingungen, unser eigenes Projekt des guten Lebens steht. Dazu kann Kunst einen Beitrag leisten, dazu kann Kulturpolitik einen großen Beitrag leisten. Und ich glaube, dieses Ziel soll man nicht aus dem Auge verlieren, vor allen Dingen soll man sich auch nicht entmutigen lassen, wenn die Rahmenbedingungen, die ich ja doch etwas negativ beschrieben habe und die ich auch so negativ sehe, sie so sind, wie sie sind - es ist unser Leben, davon haben wir nur eins, sodass es sich lohnt, sich anzustrengen, auch um vielleicht die Rahmenbedingungen zu verbessern, aber trotz allem auch innerhalb dieser Rahmenbedingungen unser eigenes Projekt des guten Lebens, also das, was man auch Glück nennt, zu realisieren. Hermann Glaser (13. Juli 2005) 
Prof. Hermann Glaser (Roßtal) im Interview Erstens: Die wichtigste Veränderung sehe ich darin, dass das, was in langen Erfahrungen in der DDR, häufig auch mit Leidensdruck, entwickelt, in manchem auch erträumt wurde, nun in einer freiheitlichen Atmosphäre hat verwirklicht werden können. Oder - man muss auch die Möglichkeitsform verwenden - hätte verwirklicht werden können. Im Verbund mit der kulturpolitischen Situation in Westdeutschland, wo man, ich glaube, bei fast allen Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeitern sehr interessiert war an einem sowohl theoretischen wie praktische Diskurs. Ich verwende den Konjunktiv, weil viele Umstände dies abblockiert haben - ein Thema, was uns ja bis heute beschäftigt, sodass also die Ideen, die gemeinsam entwickelt wurden und auch weiter verwirklicht werden hätten können, in manchem stecken geblieben sind. Und das andere besteht darin, dass sehr viele Seiteneinsteiger in der DDR, die sich nun sehr für Kulturpolitik engagierten, nun Tätigkeitsfelder bekamen, die sie auch sehr genutzt haben. Zweitens: Der kulturelle Wandel in den alten Bundesländern ist aus meiner Sicht leider negativ. Nicht, dass die Initiativen und die Engagements vieler einzelner und Gruppen und Initiativen in den Städten und Gemeinden zurückgegangen sind, aber die Politik und die gesamte gesellschaftliche Situation haben sich negativ entwickelt. Die Berliner Republik ist ja, was viele kritisieren, aber leider zu wenige, nun ursupiert worden von einem Ökonomismus oder sagen wir, von einem nicht gezähmten Kapitalismus, der eigentlich das, was auch im Rahmen sozialer Marktwirtschaft für eine demokratische, freie Kultur als Möglichkeit sich in den letzten Jahrzehnten ergeben hat, sich nicht mehr so entwickeln konnte, wie wir es hoffen. Das kann man auch ablesen an den Parteiprogrammen, die kaum noch eine wirklich engagierte Kulturpolitik fordern und fördern. Drittens: Was ich eigentlich über Jahrzehnte kulturpolitisch formuliert und erfreulicherweise mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern praktiziert habe, ist nicht beeinträchtigt durch den Zeitwandel. Es gibt bestimmte Konstanten und das was ich nun vor eineinhalb Jahrzehnten oder auch früher formuliert habe, darüber erbleiche ich nicht, wie Herr K. bei Bert Brecht, der sich ja nun, weil man ihm sagte, er habe sich nicht verändert, erschrickt. Auf der anderen Seite ist es natürlich klar, man verändert sich immer, es müssen immer die Überlegungen, die man grundsätzlich hat, auch der jeweiligen Situation angepasst werden. Aber insgesamt ist dieser Begriff einer soziokulturellen Kultur weiter gültig, die sich in Verbindung sieht mit gesellschaftlichen Fragen und Problemen, ohne deshalb die Ideen und Ideale hoch oben, also im Überbau nun zu missachten. Es ist, glaube ich, die wichtige Einheit des Wechselspiels zwischen, ich sag’s mal in Anführungszeichen, „unten“ und „oben“, der praktischen Arbeit und dem Denken. Man kann nichts auf die Füße stellen, wenn man zu wenig im Kopf hat. Viertens: Was generell für kulturgeschichtliche Entwicklungen gilt, gilt aus meiner Sicht besonders in der Situation, in der wir uns nun im 21. Jahrhundert befinden. Initiativen und Aktivitäten kommen vor allem von den Rändern. Das heißt also von kulturengagierten Personen und Persönlichkeiten, von Gruppen und Institutionen, die sich nicht so stark eingebunden fühlen in Produktionszwänge. Um es konkret zu sagen, ich vermisse eigentlich das gesellschaftspolitische Engagement in Kunsthallen, in Theatern, in anderen Einrichtungen, die jetzt mehr schauen, ob sie durch Events sozusagen den politischen Konsens herstellen. Also: es gilt das alte Wort, das am Schluss der „Träume“ von Eich steht, Kultur ist halt der Sand, nicht das Öl im Getriebe der Welt. Auf der anderen Seite gilt auch der Satz eines Anarchisten, von Bakunin, der gesagt hat, man muss der Welt entgegenkommen, um sie zu verändern. Also diese Gratwanderung auf der einen Seite mit Methoden und Inhalten, die einen breiten Konsens finden, aber auf der anderen Seite nicht das aufgeben, was eigentlich Kultur bedeutet. Das bedeutet, nicht immer Lösungen zu finden, sondern vorhandene Lösungen zu befragen, und unter Umständen nun zu irritieren. Und das hat ja dieses Wort von Eich sehr klar formuliert. Fünftens: Die Internationalisierung von Kultur hat ja zwei Seiten, wie so vieles im Leben. Die eine ist, dass auf diese Weise Verbindungen, Austausch gefördert wurden, natürlich auch durch die neuen Medien. Also das Surfen im Internet WWW ist sicher eine große Hilfe dabei. Man kann aber das WWW auch so interpretieren: oh weh, oh weh, oh weh Ausrufungszeichen! weil ja auf diese Weise Konturen verloren gehen, Informationen und auch sehr negative Elemente eingespeist werden, aber das entscheidende ist, dass - um einen anderen Ausdruck zu verwenden - Globalisierung nicht zu einer Nivellierung der einzelnen Kulturen, speziell auch in Europa, führt. Globalisierung wird ja von vielen mit Recht als Amerikanisierung verstanden, oder Mac Banalisierung. Da wird es sehr wichtig sein, dass die einzelnen Regionen und Gemeinden, Städte, Regionen, Länder ihre eigene Kultur erhalten und ausbauen. Aber gleichzeitig in einen noch intensiveren Diskurs - gerade ja auch zwischen Ost und West - eintreten, also Kulturaustausch. Was das im einzelnen bedeutet und welche Gefährdungen da entstehen, wird kulturpolitisch wichtiger. Gefährdungen nicht zuletzt auch durch die Kommerzialisierung, denn die WTO, World Trade Organisation, hat ja eine Kommerzialisierung im nationalen und regionalen Bereich zur Absicht und hier wird die Standfestigkeit der Regierungen wichtig sein, damit dadurch wichtige Elemente der Kultur nicht verloren gehen. Das ist ein abendfüllendes Thema aber die Zielrichtung ist klar: Eigenständigkeit mit Offenheit zu verbinden. Sechstens: Ich glaube innerhalb der gestellten Fragen könnte man abendfüllend, tagesfüllend und sogar noch länger alles ansprechen, was nun wichtig ist. Hier konnte nicht alles angesprochen werden, aber es sollten Impulse gesetzt werden, damit der Diskurs wieder verstärkt wird. Und das ist entscheidend: dass man heute nicht immer nur von der Hand in den Mund Tagespolitik betreibt, sondern eine antizipatorische Vernunft entwickelt, die vor allem auch wieder dem Prinzip Hoffnung, der Utopie, der Vision den gebührenden Platz einräumt. Aber leider ist die gegenwärtige Politik sowohl visions- wie utopielos und das wirkt sich natürlich im Besonderen für Kultur aus. Denn Kultur ist zwar am Tag und in der Gegenwart zu praktizieren, muss aber die Zukunft entscheidend im Auge behalten. Und zwar nicht nur eine Zukunft, die auf uns zukommt, sondern wie man die Zukunft gestalten will, das ist entscheidend und nicht als Determinismus, dem man sich ergibt und unterwirft. Albrecht Göschel (14. Juli 2005) 
Dr. Albrecht Göschel (Berlin) im Interview Erstens: Ich habe 1994, als dieser Artikel erschienen ist, sehr gravierende Unterschiede zwischen West und Ost behauptet, von denen ich nicht weiß, durch empirische Studien, ob die sich nun erhärtet haben oder sich bestätigt haben, von denen ich aber annehme, dass sie in der Tendenz richtige Aussagen waren, die die letzten Jahre, auch die letzten zehn Jahre oder die fünfzehn Jahre seit der Vereinigung geprägt haben. Das kann man an einigen Details deutlich machen. Zum Beispiel: also in der DDR gab es nach wie vor einen teleologischen Zeitbegriff, also auch Zeit, Zeitablauf, laufen auf ein bestimmtes Ziel zu, im Sinne klassischer Utopievorstellungen. Sehr viel Frustration über die gegenwärtige Politik der Bundesregierung gerade auf östlicher Seite besteht darin, dass kein Ende absehbar ist zu dieser Reformbewegung, die die SPD eingeleitet hat. Also kein Ziel, worauf es denn hinauslaufen solle. Das ist eine sehr traditionelle Politikvorstellung, die sich in der DDR, also in den neuen Bundesländern, erhalten hatte, das hatte ich damals auch gesagt und das scheint sich zum Beispiel zu bestätigen. Das zweite ist, dass auch die Vorstellung bestand, besteht, dass Staat Macht ausüben solle, also seinen Job machen solle, steuernd wirken solle - im Westen war schon sehr viel weiter die Vorstellung verbreitet, dass staatliche Macht immer begrenzt ist, dass sie selbst sozusagen gar nicht so viel ausrichten kann. Diese Vorstellungsdifferenz zwischen beiden Teilen hat sich ich glaube auch bestätigt. Die Hoffnung ist, dass ein starker Staat etwas bewirken könne. Im Westen sind diese Hoffnungen nicht sehr groß, dass es den starken Staat überhaupt geben könne. Ich glaube, auch darin war die Einschätzung von damals richtig. Auch richtig war sie vermutlich in der Vorstellung, dass die Nation so etwas wie eine Solidargemeinschaft sein soll. Das ist sie ja für den Osten auch gewesen, und ist auch immer eingefordert worden. Das hatte der Westen auch mitgetragen, aber die Hoffnungen, dass das auf Dauer so funktioniert und in jedem Fall so weitergeht, sind im Osten auf jeden Fall unverrückbar und fest, während sie im Westen erheblich in Zweifel gezogen werden, ob das tatsächlich so gehen kann. Also nicht nur, weil dadurch der Osten von der wirtschaftlichen Entwicklung abgehängt werden würde, in großen Teilen, sondern einfach sozusagen aus diesem Solidarbegriff von Gleichheit innerhalb einer Nation. Der Bundespräsident Köhler hat das ja in Zweifel gezogen, dass das sozusagen das Zielprogramm für die Zukunft sein könnte, was dann auch sofort auf den geharnischten Widerstand der ganzen östlichen Bevölkerung gestoßen ist. Da zeigen sich nicht nur politische Opportunismen in dem Sinne, dass man um die Transferzahlungen fürchtet, sondern dass man auch diesen Nationsbegriff nach wie vor im Osten für relevanter und verbindlicher hält als im Westen. Das war damals eine Einschätzung, die ich getroffen habe, die, glaube ich, nach wie vor zutrifft. Was ein entscheidender Punkt für das Kulturverständnis war, nach meiner Meinung damals in Bezug auf damals aktuelle soziologische und kulturwissenschaftliche Theorie, dass so zu sagen ein Werkzeug-Verständnis sehr stark, also ein Funktionsverständnis, ein Werkzeugverständnis von allen Dingen und Geräten und Vorgängen des Lebens im Osten bestimmender sei, während wir im Westen dieses, was wir Erlebnisgesellschaft genannt haben, sich hat entwickeln können. Ich denke, dass das auch nach wie vor richtig ist, also sozusagen die Bemühungen ostdeutscher Bevölkerung für das eigene Haus unter jeden Bedingungen, für das große Auto usw. in einer anderen Form als sagen wir Verreisen oder eine bestimmte Art von diesen Funktionsgegenständen entlasteten Lebens, also alternativen Lebensansetzen. Diese Differenz hat sich nach wie vor gehalten, auf beiden Seiten. Also das, was wir Erlebnisgesellschaft nennen, hat sich im Osten nicht durchgesetzt. Genauso wenig, wie darauf aufbauende Alternativbewegungen, die im Grunde keinen großen Raum gewonnen haben usw. Also die Grünen spielen nach wie vor in den neuen Bundesländern eine marginale Rolle. Insofern waren die Einschätzungen von damals, von vor zehn Jahren, weitgehend richtig. Man muss es insofern etwas differenzieren, das habe ich in nachträglichen Studien auch noch untersucht, es hat die Ansätze eines Wertewandels, der im Westen sozusagen sich vollzogen hat, jeweils auch in den neuen Bundesländern, also in der DDR bereits und in den neuen Bundesländern gegeben. Doch diese Ansätze sind jeweils, man kann es schlicht und ergreifend sagen, durch staatliche Repression unterdrückt worden, erstickt worden. Insofern waren Ansätze für diese Modernisierungsbewegung im Osten da, auf denen konnte die Veränderung in den letzten zehn bis fünfzehn Jahre aufbauen. Es ist nach wie vor nicht so richtig klar, auch in weiteren Studien, wie weit bereits sozusagen dieser Wertewandel, der im Westen weitgehend vollzogen war, im Osten aber eher nicht, durch diese Ansätze, durch diese Anschübe, die jeweils schon eingetreten waren, sich dann sozusagen in rapidem Tempo vollzogen hat. Aber mir scheint doch, dass die wesentlichen Differenzen, von denen wir Anfang der 90er Jahre alle geredet haben, dass die sich doch bestätigt haben, in der Weise wie ich eben versucht habe ist zu skizzieren, und dass es eben doch ungefähr eine Generation dauert, bis das sich völlig angleicht. Insofern denke ich, dass die Vermutung einer sich zumindest bei der erwachsenen Bevölkerung erhaltenden Kluft zwischen beiden Seiten, dass diese Vermutungen richtig sind und auch die nächsten zehn bis fünfzehn Jahre noch betreffen werden. Volker Gransow (22. Juli 2005) 
Dr. Volker Gransow (Berlin) im Interview Erstens und Zweitens: In Ostdeutschland und auch in Westdeutschland wie überhaupt auf dem größten Teil der Welt hat die Globalisierung des Kapitalismus seit den neunziger Jahren zu einer dominanten Kultur nach dem US-Vorbild geführt, die von Folgendem geprägt wird: 1.] Orientierung am Wettbewerb 2.] Kommerzialisierung von Kultur 3.] Glorifizierung des Konsums 4.] Verneinung von zwischenmenschlicher Solidarität und 5.] Verwischung nationaler Identitäten. Speziell in Ostdeutschland – aber nicht nur dort – hat sich wegen des Erstarkens dieser dominanten Kultur eine alternative Kultur des Pessimismus, der Resignation und der Migration herausgebildet. Gleichzeitig nahm die oppositionelle Kultur der Kapitalismuskritik zu, die ehemals in anderer Form die dominante Kultur der DDR gewesen war. Drittens: Auf die Frage „Stehen Sie zu Ihrer Auffassung von 1994?“ möchte ich mit einem klaren Jein antworten. Ja, ich stehe dazu, denn ich habe die Entwicklungen damals richtig gesehen. Nein, denn ich habe damals eine verengte deutsche Perspektive gehabt. Viertens: Wir sollten künftig unsere Aufmerksamkeit besonders lenken auf die Verknüpfung von internationalen - z.B. amerikanischen oder islamischen – mit deutschen Kulturprozessen sowie auf die deutsche Kultur in einem Europa zwischen Vertiefung, Erweiterung und Krise. Sechstens: Auf die Frage „Was ist wichtiger als Antworten auf diese Fragen?“ möchte ich antworten: praktische ökonomische und ökologische Kapitalismuskritik. Horst Groschopp (10. August 2005) 
Dr. Horst Groschopp (Berlin) im Interview Ich habe mir in Vorbereitung auf dieses Interview noch einmal angeschaut, was ich bei der Gründung der Kulturinitiative und besonders bei der Enquete-Publikation in MKF 34 so geschrieben habe. Mein Gegenstand war der „Stellungswechsel“ der Kulturarbeiterschaft, also wie aus dem ehemaligen staatlichen, gewerkschaftlichen etc. Kulturbetrieb und den dort Beschäftigten freie Kulturmitarbeiter geworden sind und was mit ihnen dabei geschah. Ich muss sagen, die Prognosen sagen – obwohl es nicht soziologisch verifiziert ist (damals war es teilnehmende Beobachtung, heute ist es teilnehmende Beobachtung): Es ist im Wesentlichen so gekommen, wie es da drin steht. Und das Erstaunliche ist, wie die Leute unterschiedlichen Alters es geschafft haben, sich an die neuen gesellschaftlichen Verhältnisse anzupassen, die ja viel individualisierter, viel kommerzialisierter sind. Und da war es dann schon erstaunlich, welche Biografien das ergab. Natürlich gibt es auch eine ganze Menge Verlierer, gerade im Kulturbereich. Aber auch das ist nicht aufgelistet, wie diese Biografien dann verliefen. Da bin ich schon bei dem wichtigsten Punkt. Also, was ist der entscheidende Wandel? Den sehe ich tatsächlich in Form der gesellschaftlichen Verhältnisse, also darin, wie Kultur jetzt funktioniert, sowohl Kultur als Summe der Selbstverständlichkeiten, wie Leute leben, als auch das Kultursystem. Und da sind ja die großen Träger weggebrochen, die Gewerkschaft, die anderen Organisationen. Das wäre noch genauer zu verfolgen, was aus den einzelnen Einrichtungen geworden ist und inwiefern die Treuhand eben eine große Kultureinrichtung war. Wenn ich jetzt gefragt werde, was ich im Nachhinein nicht so gesehen habe, dann ist es, sicher auch aus der Biografie und aus der heutigen Beschäftigung heraus, der große Bereich kirchlicher Einrichtungen, den wir nicht in seinem Wandel untersucht haben und der sich enorm ausgeweitet hat. Kirche, da ist ja zu fragen, was ist das? Das ist eine Steuergemeinschaft. Das sind Häuser. Das sind Schulbetriebe. Das sind große Wirtschaftsunternehmen. Das ist Caritas, das ist Diakonie mit über zwei Millionen Beschäftigten allein dieser beiden Träger mit Monopolstellungen – etwa in der Drogenberatung. Das habe ich nicht so gesehen und nicht so prognostiziert, dass sie eine so große Stellung auch im eher volksatheistischen Osten einnehmen werden. Auch nicht, wie viel Geld da reingeht, nicht für soziale Sachen, das ist so nicht das Problem, sondern für reine Kultangelegenheiten. Das hat mich dann schon verwundert. Auch, wie wenig Debatte es darüber unter Kulturleuten gibt, wie sich das innerhalb des Kultusbereichs so verteilt. Denn die beiden Kirchen sind eben große Kulturbetriebe, und dem muss man sich genauso widmen und genau so rational darüber denken wie über andere Kulturbetriebe auch. Und das ist weitgehend ausgespart worden. Wandel im Westen – ja, da denke ich mal, das Experimentierfeld Ost hat genügend Erfahrungen und Methoden hervorgebracht, nun auch im Westen Veränderungen vorzunehmen. Die Frage ist noch, inwiefern dies mit dem tatsächlichen demographischen Wandel in irgendeiner Beziehung steht, inwiefern dort die Gewerkschaften, die im Osten weitgehend ausgeschaltet wurden, da noch bremsende Wirkung haben. Aber ich sehe sowohl in den sozialen Situationen, wie sie da sind und wie sie zu entsprechenden Wahlergebnissen auch geführt haben. Denn heute ist der 1. Juli, und nach 15 Jahren Wirtschafts- und Währungseinheit entzieht der Kanzler sich selbst das Vertrauen, und das ist schon auch ein kulturelles Zeichen. Aber um jetzt wieder auf den Westen zu kommen, ich sehe hier ähnliche Entwicklungen in der Soziokultur, wie sie sich im Osten bereits vollzogen haben. Was mir aber viel wichtiger ist, dass es zu einer Festivalisierung des normalen Kulturlebens gekommen ist. Es muss sich alles irgendwie werbemäßig tragen und was einspielen. Und was mir weiter auffällig ist, dass die neuen Reichen auch wieder die Kultur entdecken und nach Formen suchen, sich hier auszudrücken und auch kulturell zu präsentieren. Zu welchen Entwicklungen sowohl die Verarmung und Entstaatlichung zum einen und zum anderen die Selbstdarstellung von Reichen führt, ist noch abzuwarten, auch zu welchen Protestformen, kultureller Art wie sozialer Art, das führt. Antonia Grunenberg (12. August 2005) 
Prof. Antonia Grunenberg (Oldenburg) im Interview Erstens: Ja, worin sehe ich nach 15 Jahren deutscher Einheit die wichtigste kulturelle Veränderung in Ostdeutschland? Ich sehe sie darin, dass noch immer alles in einem gewaltigen Strudel der Veränderung und Beschleunigung begriffen ist. Das Paradoxe an dieser Situation ist nur, dass diese Beschleunigung und diese Veränderung der kulturellen Standards gekoppelt ist mit einer Stagnation sondergleichen, das heißt, es ist … im Grunde sind es Effekte, die sich widersprechen und die auch zum Stillstand und zur Blockade führen. Das heißt, noch mal zusammengefasst, ich sehe eine gewaltige kulturelle Beschleunigung, ein Verschwinden alter Mentalitäten, Einstellungen und gleichzeitig ein Beharren, ein quasi erzwungenes Beharren in einer Situation des Stillstands. Und darin besteht, glaube ich, eine der großen Schwierigkeiten auch Politik zu machen, in dieser Situation. Zweitens: Die Frage zwei heißt, gab es auch in den alten Bundesländern, oder gibt es einen kulturellen Wandel, und dies würde ich eindeutig bejahen. Ich meine, man kann sagen, es gibt ihn immer. Aber worin er bestünde? Meines Erachtens besteht er darin, dass die alte, über lange Jahre gehaltene Einstellung, dass es wachsenden Wohlstand gibt und dass es immer aufwärts geht und dass die Fortschrittslinie nicht abbricht usw. - dass sich dies ganz einschneidend gewandelt hat und dass es von diesem Fortschrittsoptimismus der 70er Jahre nur noch in, oder nicht nur noch, sondern nur in Segmenten der Gesellschaft etwas übrig geblieben ist, nämlich in den neuen Ökonomien, in allen anderen hat eher so was gegriffen wie eine Reflexion des alten Optimismus oder auch die Einkehr der Angst. Drittens: Ob ich zu meiner Auffassung von 1994 stehe? Ich war damals Verhalten optimistisch, ich bin das heute auch noch, aber ich würde heute in sehr viel längeren historischen Intervallen denken. Ich denke, dass es sehr viel länger dauert, bis jenes Hervorkommen von Produktivität und Initiative, auf dass ich damals gesetzt habe, sich in einer breiteren Art und Weise betätigen kann. Viertens: Ja, die Frage nach kulturellen Prozessen, kulturelle Innovationen - das kann ich irgendwie gar nicht so beantworten. Die kulturellen Prozessen, die ich wichtig finde, sind die, die quasi global verlaufen, und irgendwie kann man die dann auch Brandenburg oder in Nordrhein-Westfalen wieder finden. Das heißt, das Problem, dass man in kulturellen Differenzen leben können muss und dies seine großen Schwierigkeiten hat, weil die vergangenen Generationen mit dem Identitätsparadigma aufgewachsen sind und damit ja nun gewaltig Schiffbruch erlitten haben. Und dieses Erlernen und Erfinden des Lebens in der kulturellen Differenz halte ich für sozusagen für unser aller Zukunft. Aber auch da würde ich sagen, dass das sehr lange dauert. Fünftens: Die Frage fünf heißt, Kultur ist international, es ist von Gefährdungen die Rede, worin sehen Sie Chancen und wo Gefahren - auf die Frage kann ich eigentlich nicht antworten, weil ich sie schon unter Frage vier beantwortet habe. Die Internationalität der Kultur ist auch eine Interkulturalität, und das ist nicht nur was harmonisches, sondern das ist auch mit Reibung und Konflikt verbunden. Und das Leben in dieser kulturellen Vielfalt, die auch eben Differenz heißt und die mit Spannungen und Reibungen und Widersprüchen und Gegensätzen verbunden ist, das betrachte ich als große Herausforderung, ob wir nun in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen oder Bangladesch leben. Sechstens: Was wichtiger ist, als Antwort auf diese Fragen - sind weitere Fragen. Horst Haase (Juli 2005) 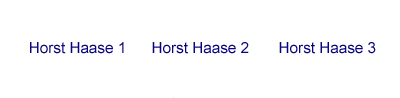
Prof. Horst Haase (Berlin) Elf Jahre nach der ersten Befragung sind auch elf Jahre verstrichene Lebenszeit, so dass ich, auf die 77 zugehend, für meine Sichtweise weniger denn damals Gültigkeit beanspruchen kann. Meine Erfahrungen sind mehr und mehr medial vermittelt, also nur beschränkt verlässlich. Vorbehaltlich dessen möchte ich mich dennoch zu den aufgeworfenen Fragen äußern, weil auch ein solcherart begrenzter Standpunkt vielleicht die eine oder andere Denkanregung geben kann. Beginnen will ich mit der dritten Frage, ob ich zu meiner Auffassung der Problematik von 1994 stehe. Ich kann sie bejahen, weil sich die wesentlichen gesellschaftlichen wie subjektiven Komponenten kultureller Entwicklung im Lande nicht grundsätzlich verändert haben und ihre damals beschriebenen prekären Seiten weiterhin existieren. Auch haben sich meine von Skepsis geprägten Erwartungen eher bestätigt denn als irrig erwiesen. Natürlich gilt das nicht für jede Einzelfrage. So sind die Erfahrungen der Wende, die freudigen wie die schmerzhaften, kaum zur Basis bemerkenswerter kultureller Innovationen geworden. Auch sind die damals erhofften Ausweitungen bestimmter Formen des Widerstands im Ringen um menschliche Würde nicht erfolgt, beziehungsweise haben sie sich in andere Erscheinungsweisen verlagert, von denen im weiteren zu handeln sein wird. Doch zurück zur ersten Frage nach den wichtigsten kulturellen Veränderungen in Ostdeutschland in den letzten 15 Jahren. Da ist vor allem festzustellen, dass die Kommerzialisierung indessen total dominiert. Ohne Moos ist partout nix mehr los. Dem sind die massenkulturellen Prozesse weitgehend ausgeliefert, und auch die sogenannte Hochkultur ächzt unter den Sparzwängen. Die schwache ökonomische Basis Ostdeutschlands verschärft diese überall im Lande anzutreffende Situation. Kulturpolitiker stehen auf verlorenem Posten. Nur wo zu verdienen beziehungsweise lukrativ Kapital anzulegen war, kam es zu positiven Veränderungen: das äußere Bild der ostdeutschen Städte, zum Teil auch der Dörfer, hat dadurch beträchtlich gewonnen, skandalöser Abriss ist die andere Seite der Medaille – für die auf hohe Mieteinkünfte setzenden Vermieter gibt es indessen viel zu viele Wohnungen. Auch die Straßen wurden besser und der motorisierte Teil der Bevölkerung erlangte eine höhere Mobilität, freilich auf Kosten des partiellen Abbaus jenes Gewinns gesunder Atemluft, der nach der Wende durch die weitgehende Deindustrialisierung erzielt wurde. Nicht speziell ostdeutsch aber auch hier gleichermaßen bemerkenswert ist der enorme Vormarsch der Computer- und Handytechnik in diesem Zeitraum, dessen kulturelle Konsequenzen – nicht zuletzt für die Jugendkultur - höchste Aufmerksamkeit erfordern. Hinzu kommt, dass unter Stichworten wie Freiheit und Pluralismus eine erschreckende Einebnung der kulturellen Landschaft erfolgt. Neue Ideen, Protest, kritische Analyse, gar womöglich leise Töne haben kaum eine Chance etwas zu bewegen. Sie verschwinden unter oberflächlichem Aktionismus, einer Flut manipulierter Bilder, schrillem Getöse, einseitigen Informationen. Ernsthafte Diskurse ersticken im Dunst unerträglichen Geschwätzes. Scheinbare Neuerungen stumpfen sich schnell ab. Ohne wirkliche Höhepunkte folgt ein Event dem anderen. Allein Spaß zu haben erscheint als Ziel vieler Bemühungen. Verlogene, abzockerische Werbung hat einen anhaltend hohen Stellenwert. Die Aussicht, unter diesen Bedingungen ostdeutsche Spezifika zur Geltung zu bringen, sind leider sehr gering und kaum jemals von Dauer. Angesichts dessen mutet es wie ein Wunder an, dass nicht wenige Menschen in den neuen Bundesländern an ihrer Ostidentität, das heißt an Prägungen durch ihr Leben in dem dahingeschiedenen Staat, festhalten; der alte Holzmichl, er lebt noch – nicht zufällig entstand dieser sich 2004 mit Windeseile verbreitende Text eines Schlager-Refrains im bundesrepublikanischen Osten. In den nachwachsenden Generationen ist das derweilen natürlicherweise immer geringer ausgebildet, wenngleich unter den Bedingungen mangelnder Perspektiven für junge Leute sich dieser Prozess auch wieder umkehren kann. Die Kluft zwischen der kulturellen Praxis breiter Massen und einer elitären Hochkultur hat sich vertieft. Das ist am besten im Angebot der öffentlichen Bibliotheken zu sehen, das zwar reichhaltiger aber auch sehr viel flacher geworden ist. Die nunmehr erreichte Gleichförmigkeit der Bestsellerlisten in Ost und West weist ebenfalls darauf hin. Zügig fortgeschritten ist die Vereinzelung der Individuen. In der Hochkultur ist sie ohnehin entscheidendes Kriterium jeglichen Urteils; in wichtigen massenkulturellen Prozessen wird sie eher kaschiert als aufgehoben oder abgeschwächt. Werte wie Solidarität oder Gemeinsinn, selbst Freundschaft, verblassen demgegenüber und sind auch durch eifrige Forderungen nicht zu kräftigen. Ein weit verbreitetes politisches Desinteresse entspricht dem. Ob das aufgeblühte Vereinsleben hier als ein Gegengewicht angesehen werden kann, erscheint mir mehr als zweifelhaft, dennoch ist es ein wichtiger kultureller Faktor. Selbst der Karneval hat nun im Osten, wenngleich noch etwas verkrampft, Boden erobert. Die demographische Entwicklung und die andauernde Emigration junger Menschen aus Ostdeutschland führen langsam aber sicher zu einem kulturellen Wandel, dessen Folgen im einzelnen noch nicht abzusehen sind, aber wohl eher stagnative als innovative Züge annehmen werden. Rentner und Pensionäre mausern sich zu den ausschlaggebenden Kulturträgern. Die Situation der im Osten zurück bleibenden Jugendlichen hingegen erweist sich zunehmend als aussichtslos, wird von Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung gekennzeichnet. Wie dem begegnet werden kann, ist mir auch unerforschlich. Es ist eine tragische Situation, die zu Verrohung und kriminellen Aktivitäten vor allem aber zum Aufleben rechten Gedankengutes beiträgt, wovon die jugendkulturelle Szene in weiten Bereichen Ostdeutschlands bereits in durchaus gefährlicher Weise beeinflusst wird. Perfektioniert wurde die Deutungshoheit über die Geschichte und Kulturgeschichte dieses deutschen Teilgebietes zwischen 1945 und 1990. Gültig ist vor allem das Urteil derer, die nicht dabei gewesen sind und die sich von der anhaltenden Empörung darüber leiten lassen, dass in der gescheiterten Gesellschaftsordnung dem ungehemmten Profitstreben Grenzen gesetzt waren. Bescheidene Zugeständnisse, wie etwa die Anerkennung der Leistungen einzelner Künstler (Christa Wolf, Bernhard Heisig), können über diesen Zustand nur hinweg täuschen. Für bemerkenswerte und öffentlich zu wenig gewürdigte Erscheinungen, die dem, wenn auch in sehr bescheidenem Maße, entgegenwirken, halte ich: 1. die sich in einer Flut autobiographischer Niederschriften darbietende Erinnerungskultur, die nicht nur ein anderes, genaueres Bild jüngst vergangener Verhältnisse zeichnet als die offizielle Historiographie, sondern auch die Chance hat, in familiäre und andere personale Strukturen hinein auszustrahlen. 2. die Fortexistenz eines Wissenschaftsbetriebes jenseits öffentlicher Förderung und mit sehr beschränkten Arbeits- und Publikationsmöglichkeiten, der sich auf die durch den Elitenwechsel eliminierten Gruppen der Intelligenz stützt und sich der in Ostdeutschland vorhandenen Probleme in besonderer Weise annimmt. Ob es – Frage zwei – in diesen Jahren auch in den alten Bundesländern einen kulturellen Wandel gab, vermag ich zwar noch schlechter zu beurteilen, halte es aber, jedenfalls was die grundsätzlichen Aspekte anbelangt, für unwahrscheinlich. Kommerzialisierung, Oberflächlichkeit, Reduzierung öffentlicher Mittel sind auch dort symptomatisch. Auffällig in den letzten Jahren ist allerdings eine stärkere nationalistische Infiltrierung der politischen Mitte, besonders in der Erinnerungskultur, in der einstmals von den 68ern eingenommene Positionen wieder zurückgedrängt werden. Zu konstatieren bleibt wohl weiterhin, dass man gerade auch im kulturellen Bereich bei der Bevölkerung der Westländer eine spürbare, teils demonstrative Abschottung gegenüber den geschichtlichen und gegenwärtigen Vorgängen in den neuen Bundesländern beobachten kann. Eines allerdings ist gerade in diesem Zusammenhang bemerkenswert: wider Erwarten hat sich Berlin nach dem Regierungsumzug zu einem kulturellen Kristallisationspunkt von europäischer Dimension entwickelt, ist zu einem weltoffenen und kreativen kulturellen Zentrum geworden. Dabei hat auch das Amalgam west-östlicher Erfahrungen, deutscher wie internationaler, eine gewisse Rolle gespielt. Zur vierten Frage. Aufmerksamkeit sollte künftig vor allem dem Bestreben gelten, in allen kulturellen und künstlerischen Bereichen eine positive, kritische und konstruktive, humanistische Sinnhaltigkeit zu stärken, mehr wirklich persönlichkeitsfördernde Bedürfnisse zu wecken und zu befriedigen. Die viel beschworene aber bisher ohne tatsächlichen Effekt geführte Werte-Diskussion könnte dabei eine beträchtliche Rolle spielen. Ansätze zu politisch entschiedenerem Auftreten, wie sie sich im Zusammenhang der globalisierungskritischen Bewegung und der Proteste gegen den Irak-Krieg und den massiven Sozialabbau noch allzu bescheiden gezeigt haben und zeigen, müssten kulturelle und künstlerische Prozesse kräftiger durchdringen. Bisher beschränkt sich das eher auf Ausnahmen. Von größter Bedeutung erscheinen mir heute und künftig die Diskurse jenseits der neoliberalen Blockade-Front. Bei gleichzeitiger Nutzung und Beförderung privater Sponsorentätigkeit wäre darauf zu dringen, die Verantwortung und finanzielle Ausstattung der staatlichen und kommunalen Kulturorgane nachhaltig zu sichern und kräftig auszubauen. Die Tendenz zu einer immer umfassenderen Privatisierung der Kultur muss gestoppt werden. Im massenkulturellen Bereich gilt das besonders in Hinsicht auf Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung der Jugendlichen. Intensiv zu arbeiten wäre an Konzepten für eine von Lohnarbeit freie befriedigende Lebensgestaltung als auch an kulturellen Projekten, in denen Arbeitslose und Arbeitende gemeinsam tätig sind, um den deprimierenden Folgen der Massenarbeitslosigkeit entgegen zu wirken. In den ostdeutschen Flächenstaaten sind die Möglichkeiten sinnvoller kultureller Betätigung auch für ältere Menschen zu bewahren und auszubauen. Die noch anhaltende Bereitschaft der jüngeren Alten zu einer aktiven Lebensgestaltung zu fördern, sollte mehr als anderswo als eine erstrangige Aufgabe kulturpolitischer Gestaltung anzusehen sein. Dem sich andeutenden Bruch zwischen den Generationen, geschichtlich nicht neu aber in unserer Epoche eine neue Qualität annehmend, ist nach Kräften zu begegnen – handelt es sich doch dabei um eine Kulturfrage ersten Ranges. Die fünfte Frage führt auf ein weites Feld. Ich sehe darauf zwei hauptsächliche Probleme. Zum einen das eines weltweit agierenden Faschismus. Wenn schon Rudolf Bahro die Gefahr einer braunen Ökodiktatur herauf beschwor, dürfte Demokratie noch eher und ohne Skrupel preisgegeben werden, sollte sie dem Profitstreben der großen internationalen Konzerne im Wege stehen. Fußtruppen werden sich finden, teils üben und marschieren sie bereits. Wachsamkeit gegenüber allen politisch-praktischen, ideologischen und künstlerischen Erscheinungsformen dieser Observanz ist oberstes Gebot und bleibt die kulturelle Verpflichtung Nummer Eins. Zum anderen das des Terrorismus, der sich durch die weltweiten sozialen Unterschiede immer wieder reproduziert. Er tangiert den Kulturbereich zentral, weil in ihm religiöse Fundamentalismen für seine kriminelle Praxis wie für das dahinter stehende politische Anliegen genutzt werden. Ist ihm vordringlich durch sachgemäßes politisches Agieren und vor allem durch wesentliche ökonomische Veränderungen zu begegnen, wäre dabei auch eine beharrliche multikulturelle Arbeit, die sich durch Provokationen nicht entmutigen lässt, außerordentlich hilfreich. Entschiedene Ablehnung terroristischer Gewalt und Offenheit und Toleranz in der Begegnung verschiedener Kulturen müssen sich unbedingt ergänzen. Eine Art neuer West-östlicher Diwan könnte dabei förderlich sein. Sechstens - wichtiger als diese Antworten sind natürlich alle in die Richtung ihrer Vorschläge gehenden künstlerischen, wissenschaftlichen, kulturell-praktischen und kulturpolitischen Bemühungen selbst. Text Horst Haase als pdf Helmut Hanke (1. Juli 2005) 
Prof. Helmut Hanke (Potsdam) im Interview Erstens: In Ostdeutschland ist vielleicht – es begann vielleicht vor fünf, sechs Jahren – eine Art etwas diffuser und sehr unterschiedlicher Ostidentität zu Stande gekommen. Die Ostdeutschen bemerken offenbar immer mehr, dass sie irgendwo angelangt sind, wo sie, mindestens denkende Minderheiten, nicht hinwollten. Sie wollten die Annehmlichkeiten der parlamentarischen Demokratie und des westlichen Wohlstandes sehr wohl gegen die Enge und Zwänge des pseudo-sozialistischen Regimes eintauschen, aber das, was ihnen jetzt widerfahren ist, das wollten sie eben nicht: Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit. Und es kommt ihnen nicht ganz geheuer vor, und sie merken auch in Begegnungen mit den sogenannten Brüdern und Schwestern, dass sie irgendwie anders sind. Dass sie da nicht recht ´reinpassen, weil sie in diesem System nicht sozialisiert sind. Vielleicht ist das mit der Ostidentität eine vorübergehende Angelegenheit, aber im Moment scheint sie mir ziemlich dominierend. Zweitens: In Westdeutschland hingegen, glaube ich, dass überhaupt nichts passiert ist, sondern im Gegenteil die Mehrheit der Westdeutschen durch die von Bundeskanzler Kohl und Gorbatschow organisierte Einheit sich noch viel mehr auf der Straße der Sieger glaubten, als sie es ohnehin schon waren. Sie haben den Osten natürlich tot gemacht mit ihrer überlegenen Produktivität und mit den zweifellos vorhandenen bürgerlichen Freiheiten, die es so im Osten ja nicht gab – Denk-, Schreib-, Rede-, Reisefreiheit, das gab’s ja so im Osten nicht – und jetzt kommt es mir so vor als außenstehender Beobachter, dass sie die jetzigen Schwierigkeiten, die die Bundesrepublik Deutschland auch in den alten Bundesländern hat, eher auf den Osten zu schieben bereit sind, weil sie denken, das ist der große Klotz am Bein, da muss man ständig Geld ´reinpumpen, was ja stimmt. Man hofft nur, dass aus den gegenwärtigen etwas krisenhaften Zuständen nicht ein Dauerzustand wird und dass bei den Westdeutschen allmählich die Einsicht dämmert, dass sich irgendwas ändern muss, und zwar nicht nur ein Regierungswechsel, sondern vielleicht etwas Wichtigeres, was ich aber auch nicht weiß. Drittens: Ich habe mich ja mit Büchner aus der Not gerettet, weil ich allein meine Ohnmacht und Verzweiflung nicht auszudrücken vermochte. So habe ich eher ein Büchner-Essay geschrieben, zu dem ich eigentlich noch stehe, auf jeden Fall stehe ich zu allem, was von Büchner zitiert wurde. Also, es ist ja einfach unfassbar, was dieser junge Mensch zu sagen wusste. Und etwas, was mich persönlich betrifft, das will ich vielleicht hier mal einfügen: „Ich werde zwar immer meinen Grundsätzen gemäß handeln, habe aber in neuerer Zeit gelernt, dass nur das notwendige Bedürfnis der großen Masse Umänderungen herbei führen kann.“ Und jetzt kommt es: „Dass alles Bewegen und Schreien der Einzelnen vergebliches Torenwerk ist. Sie schreiben, man liest sie nicht, sie schreien, man hört sie nicht, sie handeln, man hilft ihnen nicht.“ Ich habe gut zwanzig, wenn nicht dreißig Jahre meines Lebens mit Bewegen, Schreiben und Toben zugebracht, ich gehörte zu der Minderheit von SED-Gesellschaftswissenschaftlern, die sich einen anderen Sozialismus immer gedacht und für ihn auch eingetreten sind, aber was herausgekommen ist, hat man ja gesehen. Nun habe ich aufgehört, mich zu bewegen, zu schreiben und zu toben. Und, wie es in der Zauberflöte heißt, wahrscheinlich haben mir die Götter ein heilsames Schweigen auferlegt. Aber so heilsam ist es auch wieder nicht, wenn man in sich die Ohnmacht und Verzweiflung vergräbt, wird man ja nicht froh. Man leidet auch gesundheitlich, kurz und gut, mein Zustand ist ebenso miserabel wie der Zustand der ganzen Verhältnisse hier, in diesem sogenannten freien Land. Viertens: Was haben wir noch? Ja, ob es in Westdeutschland oder überhaupt in Deutschland irgendwelche Gruppen und Situationen und Institutionen gibt, die größere Aufmerksamkeit verdienen – dazu kann ich eigentlich nichts sagen, da ich diese Szene nicht beobachte, geschweige denn wissenschaftlich analysiere. Ich sehe nur, jetzt im Verhältnis zu dem, was im Osten Kunst und in Maßen auch Sozialwissenschaft bedeuteten, dass im Westen eine traurige Ödnis vorhanden ist. Ich sehe in Deutschland keine kritische Theorie und keine eingreifende und wirksame Kunst mehr. Wenn man mich fragt, welches deutsche Buch musst du jetzt unbedingt lesen, verstehe ich nicht zu sagen, was, und welche sozialwissenschaftliche Analyse lohnt sich überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, ginge es mir fast genauso. Nun hängt ja, wie gesagt, die Entwicklung der Gesellschaft nicht von Schreiben und Reden ab, das mussten wir ja nach der Wende deutlich erkennen, aber dass es nun ganz und gar sozusagen alles in Ruhe und Starre verfallen ist, das will mir gar nicht gefallen. Ich weiß aber auch nicht, wer und wie das geändert werden könnte. Fünftens: Wo sehe ich die Chancen und Gefahren – das ist eine etwas hochtrabende Frage. Die Gefahr für den Bestand des Planeten als die äußerste Dimension sind wir ja selbst. Das, was wir Menschen treiben und tun, ist unheilvoll und führt auf die Dauer zu immer größeren Belastungen von Umwelt, die Schere zwischen Arm und Reich tut sich auf, selbst in wohlhabenden Ländern wie in Deutschland gibt es mittlerweile Obdachlosigkeit, es gibt Bettler, es gibt natürlich Alkoholismus in großem Maße, Drogensucht usw., da muss man nun zur Ehre dieses feudalistisch-etatistischen Staatssystems DDR sagen: So etwas gab es im Osten nicht. Am Ende hat man für die sozialen Wohltaten, die die SED dem Volk verschrieben hat, Wohnungen, Preise Mieten etc., natürlich mit dem Staatsbankrott bezahlt, aber das Volk fragt ja nie nach den ferneren Wirkungen seiner Tätigkeit, das haben wir Deutsche im 20. Jahrhundert ja leidvoll erfahren müssen. Es wird immer mal in der Publizistik und auch in den Medien natürlich besprochen, diese Zustände in der heutigen Welt, es wird aufbegehrt, es gibt Gruppen international und Bewegungen, die sich dagegen auflehnen, aber eine Wende ist nicht in Sicht, es scheint, als ob das Kapital mit seiner gewaltigen Dominanz und der großen Fähigkeit, Länder und Systeme umzustülpen und ihnen die kapitalistischen Strukturen aufzunötigen, unaufhaltsam ist. Sie haben ja keinen wirklichen Gegner mehr. Der Sozialismus ist mehr oder weniger ausgefallen, in Europa zumindest, in Asien wandelt er sich wie in China auch zu einer Art Staatskapitalismus, wie es mir vorkommt, ist auch keine Bedrohung, weil die Chinesen auch sich selbst genug sind, was für sie natürlich sehr spricht. Ja, kurz und gut, eine Arbeiterbewegung ohne überhaupt eine größere Protestbewegung, welcher Art auch immer, gibt es in Europa, wie es scheint, nicht. Die Sozialdemokratie ist ja ausgefallen, sie versucht es ja besser zu machen als die anderen. Mal sehen, was heute ´rauskommt, wenn der Kanzler die Vertrauensfrage stellt, das ist hoch unwichtig. Sechstens: Das ist wirklich eine witzige Frage: Unbeschwert zu leben. Michael Hofmann (11. Juli 2005) 
Dr. Michael Hofmann (Leipzig) im Interview Erstens: Bei den wichtigsten kulturellen Veränderungen der letzten fünfzehn Jahre in Ostdeutschland sehe ich viele Gewinne, kulturell gesehen. Vor allem Gewinne an Reflexibilität und Sensibilität. Praktisch ist jeder in Ostdeutschland gezwungen worden, über sein Leben nachzudenken, über das was ihm wichtig ist. Und das sind ja kulturelle Prozesse, die gegen Spießertum und gegen Selbstgerechtigkeit wirken. Und insofern glaube ich, ist in Ostdeutschland eine Menge gewachsen, auch wenn es notgedrungen ist. Auch die neue Pluralität, die man verarbeiten musste, die Vielfältigkeitserfahrung - also hier ist eine Menge passiert und als Ursachen gibt es erst einmal die Erfahrungserweiterung durch Reisen, durch Multikulti, durch den Konsum und Wohlstand, die ganze Internationalität, das neue Essen. Also hier ist eine Menge Bereicherung, kulturelle Bereicherung im Osten zu sehen und eine zweite Ursache kultureller Gewinne liegt in den neuen Identitätskonstrukten. Also die Ostdeutschen sind plötzlich zu einer Minderheit geworden, gewissermaßen wurden Kultur oder kulturelle Anstrengungen als Kompensation für die geringere institutionelle Verankerung der Ostdeutschen in Deutschland benutzt. Und da gibt es eigentlich zwei Konstrukte. Einmal dieses klagende Konstrukt der armen Ostdeutschen, und ein Konstrukt, was noch nicht so richtig deutlich ist, was eben ein neues Patchwork, eine neue, eher optimistische ostdeutsche Identität zum Ausdruck bringt, über die wir dann vielleicht noch reden könnten. Zweitens: Nächste Frage? Na gut, dann ziehe ich das einfach mal durch hier. Gab es auch in Westdeutschland einen kulturellen Wandel? - aber selbstverständlich, denn Wandel ist ja ein Prozess, der sich immer vollzieht: Aber nicht mehr so sehr im Sinne von Inglehart, dass sich immer mehr postmoderne Werte angeeignet werden, ich glaube sogar, inzwischen ist es so, dass wir materiell an den postmodernen Werten im Westen festhalten. Also das es eher wieder eine Vermaterialisierung dieser Entwicklung gibt, ein Festhalten, ein Verteidigen, und das kann man ja auch als einen konservativen Schwenk des kulturellen Wandels bezeichnen. Nein! in dieser Frage was die deutsche Vereinigung anbetrifft. In Westdeutschland hat die Vereinigung mit Ostdeutschland kaum Impulse für einen kulturellen Wandel hervorgerufen. Zum Beispiel wenn man diese Pilawa-Show betrachtet, die jetzt im Fernsehen lief, mit Hits der vergangenen Jahrzehnte. Es war nicht ein ostdeutscher Hit dabei. Aber nicht, weil die gesagt haben, die Ossis interessieren uns nicht, das finden wir furchtbar, was die hatten - sondern die haben es schlichtweg vergessen. Und das ist doch ein schlagender Beweis dafür, dass es hier leider keine Impulse gegeben hat für einen kulturellen Wandel im Westen. Nichts, gar nichts, da ist ja auch die Rede von den Ampelmännchen und dem Linksabbiegepfeil als den Relikten des Wandels, die auch im Westen angekommen sind - und da ist leider was dran. Drittens: Stehen sie zu ihren Auffassungen von 1994? Ja - ich könnte jetzt als gelernter Ostdeutscher sagen: wir stehen voll inhaltlich hinter den Beschlüssen von 1994! Und zwar aus zwei Gründen. Wir fragten damals, was sind denn die Ursachen eines kulturellen Wandels. Und da haben wir gesagt, die Ursachen liegen eben nicht in den Normen oder in den moralisierenden Aufforderungen verschiedener Eliten Westdeutschlands oder auch Ostdeutschlands, wie die Ostdeutschen gefälligst zu sein haben, sondern die Ursachen für einen Wandel liegen in offenen sozialen Räumen, in Bewegungsfeldern und die sind - etwa für Industriearbeiter überhaupt nicht da gewesen, im Gegenteil, die Räume waren geschlossen. Also sind diese Anforderungen für kulturellen Wandel völlig aus der Luft gegriffen. Und die zweite Frage, die wir damals stellten, war die Frage, wie geht kultureller Wandel eigentlich vor sich. Und da haben wir damals von den Generationen gesprochen. Es gibt eben offene soziale Räume nicht immer. Es sind historische Gelegenheitsstrukturen, die ganz bestimmte Erwartungshorizonte und Handlungsspielräume für eine bestimmte historische Zeit und für eine bestimmte Generation öffnen. Und dieses Lebensgefühl, diese Einstellung, die vererbt sich dann auch wieder. Und deswegen haben wir uns damals völlig zu Recht dem Ausspruch von Huinink angeschlossen, dass wahrscheinlich in Ostdeutschland verschiedene verlorene Generationen aufeinander folgen, denn wenn dieser Erwartungshorizont und diese Handlungsspielräume für eine Generation der Eltern nicht da war und ist, dann spüren die Kinder das, dann werden diese Einstellungsmuster praktisch auch vererbt. Und wir haben ja jetzt kaum noch offene soziale Räume, so dass diese verlorenen Generationsfolgen relativ realistisch sein werden. Und: man ist ja immer gut beraten in solchen Zeiten eher pessimistische Prognosen abzugeben, das liegt ja auch an der Zeit und an diesen kulturellen Vorsichtigkeiten, die wir jetzt kennen. Viertens: Welche kulturellen Prozesse sind in Ostdeutschland eigentlich am interessantesten? Also ich glaube, durch die geringere institutionelle Verankerung der Ostdeutschen im System der Bundesrepublik, ist die Kultur eben besonders wichtig. Auch ist sie ein noch offenes Feld - Kulturforschung im Osten ist also insgesamt interessant, hier ist noch vieles möglich, hier kann man noch vieles sehen. Aber eben nicht, wenn man „die“ Ostdeutschen ins Visier nimmt. Es sind eher zwei Tendenzen, für die wir uns interessieren und zu denen wir auch arbeiten. Das ist einmal die Frage, was wird aus den Arbeitern? Das ist eine interessante Frage, weil wir wissen, dass so etwas wie Mentalität oder habituelles Grundmuster nicht verschwindet. Es wird vererbt, es strukturiert sich um, setzt neu an, es gibt ein Recycling von Mustern - aber Arbeiter bleiben von ihrer Kultur her Arbeiter. Die werden nicht einfach Intellektuelle oder irgend etwas anderes, moderner Arbeitnehmer - man kann die so nennen, aber die Grundmuster bleiben erkennbar über lange historische Zeiträume und deswegen ist es interessant zu fragen, was wird aus einer ehemaligen Industriearbeitergesellschaft die keine Industriearbeit mehr hat. Wie werden diese Muster weiter vererbt, wie verwandeln sie sich, ohne dass sie sich grundlegend von den traditionellen Mustern unterscheiden. Und da gibt es eben zwei Forschungsfelder. Das ist einmal die neue Kultur der Unterschichten, also die Frage, was man unter Enttraditionalisierung fasst. Und das andere ist etwas, was überhaupt noch wenig erforscht ist, das sind diese neuen Kulturen der Selbstausbeutung, dieses unbedingt auf ehrliche Art und Weise mit seiner Hände Arbeit Geld verdienen zu wollen und zu müssen. Dieses Facharbeitermuster führt zu einer unglaublichen Welle von - wenn man so will – kultureller Verarmung Verelendung oder Vereinsamung. Die Leute strengen sich an, sind mobil, pendeln und die Leiden, die hier entstehen, das ist auch ein interessantes Forschungsfeld. Und das zweite Forschungsfeld auf diesem Gebiet sind die neuen Szenen und Milieus in Ostdeutschland. Es gibt jene interessante Generation, die in der Wendezeit sozialisiert wurde. Die haben historische Erfahrungen gemacht, die es in dieser Form in Deutschland nicht gibt, und die haben die Chance, auch neue Muster (Sinus spricht von aufstiegsorientierten Pioniermilieus und neuen Szenen) zu entwickeln. Und die müssen wir im Blick behalten und nicht immer nur die Klagegemeinschaften untersuchen. Fünftens: Internationale Chancen und Gefahren - Puh! Es gibt keine neuen Chancen oder Gefahren in der Kultur, es sind immer noch die alten. Und die Hauptgefahr ist immer noch die alte: die Verkommerzialisierung. Die emanzipatorische Kraft unserer westlichen Kultur droht hier verloren zu gehen. Das spüren wir ja gerade als Ossis, und deswegen wird ja so viel moralisiert in dieser Gesellschaft, weil diese Moral mit der emanzipatorischen Kraft der westlichen Kultur zusammenhängt. Der aufklärerische Gestus, all das, was uns wichtig ist, ist nur im Doppelpack zu haben. Man kann nicht die Schönheiten der westlichen Kultur als ästhetischen Kommerz verkaufen, ohne dass die Moral daran Schaden nimmt. Und das ist die alte Frage, und wir brauchen wahrscheinlich auch wieder so etwas wie eine Erneuerung hier auf diesem Feld, die diese emanzipatorische und moralische Kraft der westlichen Kultur wieder mehr zur Geltung bringt. Sechstens: Und das Letzte war ja diese schöne Frage, was ist wichtiger, als diese Fragen beantworten - das ist ganz einfach. Gitarre spielen und ins Theater gehen, also Kultur zu machen. Wolfgang Kaschuba (10. August 2005) 
Prof. Wolfgang Kaschuba (Berlin) im Interview Ich will in vier Punkten Bilanz ziehen. Der erste richtet sich noch mal zurück an die Prognosen und Einschätzungen von vor zehn Jahren. Leider – so habe ich bei der Lektüre meines damaligen Textes festgestellt – habe ich in manchen Punkten mit meiner damaligen Skepsis Recht gehabt. Das Ost-West-Verhältnis - habe ich damals gedacht - wird noch lange Zeit nach dem Modus „eigen und fremd“ behandelt werden. Und im öffentlichen Diskurs ist es doch vielfältig so: das Eigene und das Fremde, das sind immer die anderen und wir hier in Deutschland haben unseren eigenen inneren Anderen. Dazu tragen die Medien allerdings sehr viel bei. Die Form, wie Statistik aufgebaut wird, die Form, wie Nachrichten präsentiert werden, verlängert diese Ost-West-Differenz. Ich hatte überlegt, wie sich tatsächlich Wir-Gefühle entwickeln können, also das, was wir neudeutsch Identitäten nennen. Und es ist offenbar in der Tat sehr schwierig, solche Wir-Gefühle zu entwickeln, sowohl regionale Wir-Gefühle wie gemeinsame deutsche Wir-Gefühle. Aber das ist ja für die deutsche Geschichte ja nichts Neues. Ich hatte mir große Schwierigkeiten vorgestellt auf der Ebene der Lebensgeschichten und der Lebensläufe. Welche Lebenserfahrungen, welche Lebensentwürfe mit Osthintergrund sind „legitim“? Und in der Tat ist dies, glaube ich, für viele Menschen eine Riesenproblematik. Zentral natürlich durch die hohe Arbeitslosigkeit, aber nicht nur daraus und dadurch. Ein Ost-Lebenslauf ist nach wie vor nicht der „normale“ Lebenslauf und darunter leiden sehr viele Menschen in den neuen Bundesländern. Ich hatte damals auch eine dramatische Wende in der Alltagskultur beobachtet. Viele DDR-Alltagsgewohnheiten sind beendet. Selbstverständlichkeiten etwa im Arbeitskontext - sehr hohe rituelle Dichte von kleineren Wir-Gruppen, Ehrungen, Honorierungen im Arbeitsbereich, sehr viele Formen natürlich auch von Freizeitangeboten und anderem, die heute verschwunden sind. Und damit sind kulturelle Selbstverständlichkeiten verschwunden. Das wissen gerade die Ethnologen. Schließlich hatte ich eben auch befürchtet, dass durch diese Ungleichgewichtigkeit im Ost-West-Verhältnis ein Stück Opfermentalität entsteht. Und ich glaube, die gibt es vielfach. Ich habe gerade auch das Gefühl, bei Teilen der ehemaligen DDR-Elite ist diese Opfermentalität stark ausgeprägt, und der Verlierer-Diskurs, der aber keineswegs nur ein Ost-Diskurs ist, der auch für den Westen gilt, ist gegenwärtig sehr stark. Was ich damals noch unterschätzt habe, und was ich am dramatischsten finde, ist freilich die Ebene der Zivilgesellschaft. Defizite in sozialer und politischer Hinsicht, die verstärkt werden durch politische Irritationen wie durch Abwanderungstendenzen, weil natürlich in der Tat auch viel Wissen, viel Ausbildung und vieles andere, was hätte stabilisieren können, nach Westen abgewandert ist. Und die vielfach zu beobachtende zu geringe Eigeninitiative lähmt natürlich vieles auf niederer Ebene. Und das wäre mein zweiter Punkt. Ich finde - neben der zentralen Frage natürlich der Ökonomie und Arbeitsplätze - die Schwäche der kulturellen Infrastruktur in den neuen Bundesländern schlagend. Es gibt sehr viele Formen von Sozialkultur und institutioneller Kultur eben nicht mehr. Dadurch, dass politische Organisationen weggebrochen sind, dass die Betriebe weggebrochen sind, dass die Jugendorganisationen weggebrochen sind, findet natürlich ein Prozess, um es mit Max Weber zu sagen, fortschreitender Entgemeinschaftung statt. Also es wird in diesem Sinne nicht mehr vergesellschaftet und vergemeinschaftet, sondern entgemeinschaftet. Das ist ideologisch auf vielen Ebenen sicherlich zu begrüßen, dort, wo die Vergemeinschaftung in gefährliche Richtungen ging. Aber es ist nichts an die Stelle getreten. Wir haben ein Defizit an klassischen europäischen Strukturen, der Soziabilität wie etwa den Vereinen im Osten. Der Verein als Formgeber lokaler Identität und lokaler Aktivität ist im Osten noch relativ schwach, wenn ich das richtig sehe. Die Jugendkulturen sind relativ schwach. Das FDJ-Monopol hat hier eine schlimme Schneise der Verwüstungen hinterlassen. Es gibt kaum neue Gruppenkulturen außer den Neonazis. Und das finde ich eben auch gerade den Bereich, der uns heute sehr interessieren muss: was machen männliche Jugendliche, junge Männer? Dort finde ich diesen Einbruch auch von Gewaltkulturen dramatisch, der zwar überall stattfindet, aber in manchen ländlichen Regionen eben besonders schlimm. Ich bin Wochenend-Uckermärker, ich weiß alltagsmäßig wovon ich rede. Die lokale Identitätsarbeit beginnt nur sehr allmählich. Es tut sich zwar etwas, aber da wäre noch sehr viel mehr zu tun, um eben auch diese Form von lokaler Bindung stärker zu machen, die letztendlich auch hilft, Initiativen zu entwickeln und Abwanderung einzudämmen. Und es gibt ein extremes Defizit an Alltagsritualen bei Arbeit, Schule, Feste, Feiern. Ich glaube, dass dort dieser Begriff von der Ostalgie, der vielfach benutzt wird, seine Berechtigung und auch seinen Wurzelgrund hat, weil die vielen kleinen symbolischen Bestätigungen, die der Alltag in der DDR bereit gehalten hat, auf den unterschiedlichsten Ebenen für die verschiedensten Generationen und für die verschiedensten Zwecke, heute fast völlig fehlt. Es gibt kaum mehr eine Art „Anerkennungskultur“, die natürlich primär über Arbeit organisiert war. Und wenn die Arbeit fehlt, fehlt auch diese Bestätigungskultur. Das scheint mir ein ganz zentrales Defizit. Drittens - und dazu nur zwei Sätze: solche Probleme haben auch die alten Bundesländer. Das sind nicht nur spezifische Probleme der neuen Bundesländer. Aber es gibt dort zum Teil andere Traditionen und andere Grundsubstanz. Ich will nur zwei Dinge nennen, die mir als Atheist dennoch wichtig sind: die kirchlichen Einflüsse sind relativ stärker in manchen der alten Bundesländer, auf der Ebene von Sozial- und Jugendarbeit: Und es gibt eben zum Teil eine andere Grundsubstanz, Stichwort: Vereine, eine sehr breites Vereinsspektrum, das gerade auf lokaler Ebene manches ausbalanciert. Viertens schließlich und letztens: Kultur wird immer wichtiger, gerade angesichts der Defizite. Und wenn es eine Art Ermutigungspolitik geben kann, die gerade auch in Standorten mit Schrumpfungstendenzen, die gerade auch in ländlichen Regionen mit erheblichen Rückständen wirksam werden kann, dann muss sie im sozialen und kulturellen Bereich kommen, denn über den ökonomischen kommt im Moment zu wenig. Es muss viel mehr Initiativen geben, von den Jugendlichen bis zu den Senioren. Es muss viel mehr lokale Foren der Auseinandersetzung geben, aber auch der Verantwortung für das Lokale. Gerade auch im Blick auf den Umgang mit Neonazis wie mit vielen anderen Fragen. Und es muss - und das wäre für mich ganz zentral und das scheint mir auch überhaupt mit die Zukunftsperspektive der neuen Bundesländer zu sein, an der sich das Schicksal vieler Standorte entscheiden wird - sichere Räume und Orte von Kindheit und Jugend geben. Das meint Bildung, Ausbildung, Wissen und vieles andere mehr. Wir brauchen eine „soziale Schule“ – gerade hier. Wenn wir überall die Beobachtung machen, dass die Einflüsse der Elternhäuser und die Einflüsse von Jugendgruppenkulturen auf die Kinder zu schwach oder zur negativ sind, dann muss eine „soziale Schule“ eintreten - als ein sozialer Raum, in dem die Kinder und Jugendlichen einen Großteil ihrer Zeit verbringen, aber auch einen Großteil ihrer Interessen einbringen können. Und das muss und kann nur die Schule sein. Die Standortwahl vieler Eltern in der Zukunft wird sich danach richten, ob ihre Kinder solch einen Raum finden. Kommunen müssen also nicht nur Arbeitsplätze vorrätig halten, sondern sie müssen vor allem auch Standorte für solche Bildungs- und Ausbildungssituationen der Kinder sein. Und da gibt es sicherlich in den neuen Bundesländern viele Defizite, aber eben auch viele Möglichkeiten. Dazu würde ich eben auch ermutigen – den Mut zu haben. Ende der Durchsage. Thomas Koch (10. August 2005) 
Dr. Thomas Koch (Berlin) im Interview Erstens: Ja, also aufgefordert wurden wir ja, die wichtigste kulturelle Veränderung zu nennen. Auf eine mag ich mich nicht festlegen. Ich will mehrere nennen, im Osten scheint mir die Brechung des Selbstbewusstseins der arbeitenden Klassen die wichtigste zu sein, die Wiederkehr des Tagelöhners, die Entstehung einer Kategorie überflüssiger Menschen, so genannter überflüssiger Menschen, dann Utopieverlust bei den auf das sozialistische Projekt verpflichteten Minderheiten. Schließlich wäre noch hervorzuheben der unkomplizierte Zugang zu zeitgenössischen technischen, alltagsrelevanten Errungenschaften vom PC über MP3-Player, Internet bis zu Navigationssystemen und wer das will, der unkomplizierte Zugang zu Bewegungen, kulturellen Leistungen aus aller Welt. Zweitens: Im Westen hat's auch einen kulturellen Wandel gegeben. Vielleicht lässt sich der so auf den Punkt bringen: 1989/90 fanden sich Eliten wie Nicht-Eliten der Alt-Bundesrepublik, zusammen in einem Festival der Selbstgefälligkeiten. Und davon ist nichts mehr übrig geblieben. Heute ist jede politische und soziale Kraft in Deutschland auf mehr oder minder umfangreiche Reformen aus, klagt Verkrustungen aller Art an. Der Unterschied besteht nur in der Richtung des erforderlichen Wandels, der gesehen wird. Also diese Selbstgefälligkeit ist vorbei und es entwickelt sich das Gespür, dass der Aufbau Ost als Nachbau West gescheitert ist. Drittens: Tja, die dritte Frage war, ob ich denn, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, noch zu der Diagnose aus dem Jahre '94 stehe. Also, '94 hatte ich einen Text geschrieben "Vermutungen über den kulturellen Wandel. Die entwicklungsnationalistische Episode in Ostdeutschland". Und den habe ich nun im Vorgriff auf das heutige Datum und die erneute Enquete noch mal gelesen und ich kann sagen, ich finde den Text immer noch recht gut, den ich damals geschrieben habe und ich kann dazu stehen. Ich ging damals davon aus, dass es eine Reihe von Rahmenbedingungen gibt, von denen ich annahm, dass sie mehr oder weniger stabil bleiben und habe dann Verlaufsbahnen des kulturellen Wandels versucht zu identifizieren. Der Zeithorizont betrug dreißig Jahre. Nun bin ich in der glücklichen Lage, nicht jede Vermutung, die ich damals äußerte, muss schon eingetroffen sein oder als falsch sich erwiesen haben, weil nur ein Drittel dieser Zeitspanne, rund zehn Jahre, verflossen ist. Also bei den Rahmenbedingungen will ich's mal so sagen, die sind aus heutiger Perspektive unterschiedlich scharf oder unscharf formuliert. Zum Beispiel Rahmenbedingung Nummer 1 war, die äußeren und inneren Entwicklungsbedingungen der Bundesrepublik werden relativ stabil bleiben. Diese Annahme ist aus heutiger Sicht relativ schwammig, denn, wie schon gesagt, gibt es heute keine politische oder soziale Kraft in Deutschland, die nicht grundlegende Reformen einklagen würde, was ja soviel heißt, dass sich allerlei geändert hat und es nicht mehr so weitergeht. Aber, da diesem Reformeifer Institutionen, Mentalitäten als bewahrende Kräfte gegenüberstehen, kann diese Rahmenbedingung noch halbwegs als, na ja, als gültig angesetzt werden. Also, so schnell wird's ja nicht mit den Veränderungen. Zweite Rahmenbedingung, die hat sich bewahrheitet: im Innern wird Deutschland ein Staat sein, der in zwei Gesellschaften zerfällt. Das ist, glaube ich, noch immer so. Rahmenbedingung drei war, dass sich so etwas wie eine Renaissance ostdeutschen Wir- und Selbstbewusstseins abzeichnen würde, das ist eingetroffen. Allerdings ist nicht eingetroffen, dass an die Träger des ostdeutschen Wir- und Selbstbewusstseins die Definitionsmacht und das Gesetz des Handelns im Osten übergegangen wären. Die Chancen oder Gefahren, dass das so kommt, stehen meines Erachtens fifty-fifty, weil jetzt jeder weiß, dass der Aufbau Ost als Nachbau West gescheitert ist. Das wissen auch die Entscheidungsträger im Osten. Und der Nachbau West in der bisherigen Version, der geht nicht mehr, weil ja die Alt-, die Bundesrepublik an Haupt und Gliedern verändert werden soll. Mithin ist sozusagen das Modell abhanden gekommen. Ja, die vierte Rahmenbedingung, die ich annahm, war, dass sozusagen Ostdeutschland für eine Generation Transferzahlungen erhalten wird. Wenn man den Solidarpakt II bis 2019 einbezieht, könnte man sagen, ja, das wird wohl so sein. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die Alt-Bundesländer auch zu ihren Zusagen stehen und das auch tatsächlich einhalten werden. Eines ist aber vielleicht klar, einen Solidarpakt III wird's nicht geben. Von diesen Rahmenbedingungen ausgehend, die sich mehr oder weniger als zutreffend erwiesen, habe ich auf Verlaufsbahnen des Wandels geschlossen. Die Verlaufsbahnen können stehen bleiben, nur die letzte, wichtigste, die ist nicht so eingetroffen. Ich nahm an, es gibt eine kräftige Zuwanderung nach dem Osten von Einheimischen und Angehörigen anderer Völker und es entsteht ein neues und anderes Volk. Das ist nicht eingetreten. Aber ich will, ich möchte mich noch nicht von dieser Vision verabschieden, weil ich sie für wichtig halte. Viertens: Dann die nächste Frage, da ging's um Innovationen, ob denn im Osten sich irgendwelche kulturellen Innovationen abzeichnen. Also, meines Erachtens gibt es in Ostdeutschland eine Fülle innovationsträchtiger Prozesse. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass hier eine Reihe von kulturellen Innovationen vorprogrammiert ist, aber es sind mögliche Durchbruchstellen auch zu kulturellen Innovationen gegeben, die sich identifizieren lassen. Ich will mal ein paar innovationsträchtige Gegebenheiten nennen. Da ist zunächst die Suche nach Lösungen, die Ostdeutschland zu einer selbsttragenden Wirtschaftsentwicklung verhelfen sollen. Das ist ein innovationsträchtiger Prozess, wobei nicht klar ist, ob es dann auch zu solchen Innovationen kommt. Ein innovationsträchtiger Großprozess ist der demografische Wandel. Nahezu alle Organisationen, Institutionen müssen sich auf eine älter werdende Bevölkerung, ihre Bedürfnisse, Gebrechen usw. umstellen. Auf der anderen Seite ist auch Wandel oder eine Innovation angesagt, wenn man bedenkt, dass in vielen Regionen die jungen Leute weniger werden und was es bedeutet, wenn 15/16-jährige nur noch zwei oder drei ihresgleichen an einem Ort finden, weil ja die Geburten zurückgehen. Was das dann heißt, wenn die dann also vereinsamt in einer Region leben. Da muss also irgendwas abgehen. Kulturelle Innovationen zeichnen sich dann ab oder sind möglich in schrumpfenden Städten, Dörfern und Regionen. Träger und Mitgestalter solcher Innovationen könnten Stadtverwaltungen, regionale Planungsgemeinschaften oder rührige Vereine sein. Dann gibt es zwischen Ostesee und Erzgebirge eine Reihe faszinierender Ideen, die nicht nur, die über die Träger hinaus andere inspirieren, darunter auch Künstler, Designer und sonst was. Also, ich will hier mal ein Beispiel nennen: mich hat immer die Idee fasziniert, in Brand, also in Brandenburg Luftschiffe zu bauen. Nun ist ja dieses Projekt gescheitert, aber die Idee ist noch nicht völlig vom Tisch. Es gibt Anzeichen, dass es an einem anderen Ort Luftschiffe anderer Art geben könnte. Dann gibt's das Leitbild der Barrierefreiheit. Das ist ja nun nicht originär ostdeutsch. Damit ist zunächst gemeint, dass räumliche Barrieren für Behinderte geschleift werden. Das wäre schon mal ein innovativer Prozess. Aber das Leitbild der Barrierefreiheit kann ja erweitert werden. Es rückt nicht nur räumliche Barrieren, die Menschen den Zugang zu irgendetwas erschweren, sondern auch soziale Barrieren wieder in den Blick. Kulturelle Innovationen sind zudem im Zuge des Umbaus des Sozialstaates, des Bildungswesens, der Bundeswehr und sonstiger Bereiche zu erwarten. Überdies leben in Ostdeutschland interessante religiöse und kulturelle Minderheiten, von denen was ausgehen könnte. Eine will ich jetzt nur mal hervorheben, das sind die jüdischen Gemeinden. Die jüdischen Gemeinden zeichnen sich in Deutschland und auch in Ostdeutschland dadurch aus, dass sie mehrheitlich aus Menschen bestehen, die aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion zugewandert sind. Die leben alle oder fast alle in irgendwie prekären soziale Verhältnissen und haben ein, sagen wir mal, sehr unterschiedliches Verhältnis zum Judentum in seinen zeitgenössischen Spielarten und die unterziehen sich irgendwie einer nachholenden jüdischen Sozialisation. Aber es ist etwas anderes, als die Restbestände des in Deutschland aufgewachsenen und lebenden Judentums und man weiß nicht, was da am Ende herauskommt, aber irgendwas zeichnet sich da ab und darum finde ich das spannend. Fünftens: Die letzte Frage bezog sich auf das Internationale, ob ich da irgendwelche Gefahren oder sonst was sehe oder positive Entwicklungen. Die Frage ist vielfältig interpretierbar, ich will sie in bestimmter Weise fokussieren auf die Beziehung verschiedener Kulturen im Weltmaßstab und auf das sogenannte transatlantische Verhältnis. Einen Kampf der Kulturen befürchte ich eher nicht. Aus einer dezidiert ostdeutschen Perspektive scheint mir aber eine Herausforderung darin zu bestehen, dass aus dem Osten Deutschlands Antworten, Einspruch und Widerspruch, sagen wir mal zu den Vereinigten Staaten von Amerika als Staat, Supermacht, als in bestimmter Form verfasstes marktwirtschaftliches System erwachsen sollten oder müssten. Warum? Nun, die westdeutschen Eliten und die Eliten unserer ehemaligen Bruderstaaten im Osten neigen entweder aus Interessenkalkül oder aus dem Gefühl einer Wertegemeinschaft heraus zu einem vorauseilenden Satellitenbewusstsein. Da hat der Osten so etwas wie eine welthistorische Mission, hier ein bisschen Sand ins Getriebe zu streuen und... okay, Punkt. Dieter Kramer (14. Juli 2005) 
Prof. Dieter Kramer (Frankfurt/M) im Interview Erstens: Ich freue mich über dieses Interview und habe auch meinen Text von damals noch einmal angeschaut und bin auf einige Fragen und Probleme gestoßen. Ich bin ja nun Wessi, d. h. ich kann die Perspektive kultureller Veränderungen in Ostdeutschland überhaupt nicht so genau überblicken. Ich weiß nur, dass es damals einige interessante dynamische Entwicklungen gab, wo viele Leute, einige Leute sagten, o, das könnten wir eigentlich bei uns ins Stammbuch schreiben, könnten wirs nur xxxxx. Dazu zählte nicht nur der grüne Pfeil oder das Ampelmännchen - ob wohl ich gesehen habe, Ampelmännchen gibt es jetzt auch im Heidelberg - sondern solche Dinge wie der runde Tisch, wo der Biedenkopf gesagt hat, ja das ist eine Form, in der man Übereinstimmung, etwas Neues, was vorher niemand von denen, die am Tisch sitzen, schon kannte, dass man Neues produzieren kann. Oder ich erinnere mich - ich weiß nicht, was daraus geworden ist - an das Dorf Wulkow, was ein Öko-Musterdorf werden wollte, oder an die Foron-Geschichte von Schwarzenberg - ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Aber solche Sachen fand ich damals interessant, und hätte ich mir gehofft, dass was daraus wird. Natürlich gibt es auch in den neuen Bundesländern Wandel, da brauchen wir nur auf den Abbau der Sozialsysteme usw. zu sehen, natürlich ist Kultur, sind Kulturprozesse sehr dynamisch, so ist zu sehen, was sich in 10 - 15 Jahren alles schon verändert hat, ist - aus der Frankfurter Perspektive - die Selbstverständlichkeit des Umgangs mit dem Fremden, als Selbstverständlichkeit nicht einfach der multikulturellen Gesellschaft sondern einer Stadt, eines städtischen Lebens, zusammengesetzt aus vielen, vielen, unterschiedlichen Elementen, dass was Urbanität eigentlich ausmacht, schon immer ausmacht, ist heute mit Selbstverständlichkeit auch multiethnisch, multireligiös usw. Das sind Veränderungen, die mir in den alten Bundesländern besonders aufgefallen sind. Die dritte Frage, hier geht es um die Frage, ob ich zu meinen Auffassungen von 1994 stehe. Nun ja, wir haben so formuliert, dass sie zwar aus dem Zeitrahmen heraus sich Gedanken machten, aber ich habe der Dinge aufgegriffen, die mir immer noch sehr wichtig sind. Da ist z. B. die Frage der investiven Sozialpolitik. Davon redet man heute nicht mehr. Heute man Sozialpolitik mit Zwang und mit entsprechendem Druck versucht man das soziale Niveau runterzuschrauben. Damals, wie diese investive Sozialpolitik ohne Zwang angedacht war, habe ich wiedergefunden hier im Museum der Weltkulturen bei meiner Beschäftigung mit Problemen der Dritten Welt, der sogenannten Dritten Welt, wo dieses Stichwort Empowerment eine zentrale Rolle spielt, in den internationalen Diskussionen auch - schwer zu übersetzen, denn Empowerment bedeutet eigentlich, die eigenen Kräfte wecken und mit Hilfe der eigenen Kräfte neue Chancen sich zu erarbeiten, auch zu erwirtschaften. Es gibt die XXX-Bank (unverständlich, D.M.), die Kleinkreditbank, die jetzt auch immer wieder diskutiert wird, wo die Gründer davon ausgehen, jeder Mensch hat irgendetwas, was er nutzbringend für andere anwenden kann. Dazu muss man ihn ermutigen, muss man ihm eine Chance geben und die machen es mit Kleinkrediten. Man könnte es - und das war damals meine Vision, meine Vorstellung - wenn es denn schon so ist, dass es Arbeitslose gibt, und wenn es denn auch wirklich so ist, dass man sparen muss am Sozialsystem, dann kann man wenigstens die Leute ermutigen, sich selbst zu helfen und entsprechende Nachbarschaftshilfe, diese virtuellen Geldsysteme, Tauschringe usw. zu ermutigen. Das wäre etwas gewesen, damit hätte man auch Reformen - sofern sie denn wirklich gewesen wären - abstützen können. Man hätte sagen können, o. k. wir müssen jetzt hier Einschnitte machen, aber gleichzeitig ermutigen wir euch, Selbsthilfe, eigene Aktivitäten zu machen - dass geht hin bis zu den bei mir immer sehr beliebten Schrebergärten - über die Isolde Dietrich eine so schöne Arbeit gemacht hat - und wo ich gerne noch wüsste, was aus den Schrebergärten in den neuen Bundesländern, was daraus geworden ist. Denn ich bin gewohnt, aus meiner Jugend, dass man in Notsituationen, in Notzeiten, in der Nachtkriegszeit im Schrebergarten, im Hausgarten ne Menge Ressourcen sich erwirtschaftet hat. Auch insofern stehe ich zu diesem Stichwort "investive Sozialpolitik", und Elastizität zu erreichen mit Hilfe von solchen Möglichkeiten die eigenen Kräfte zu wecken. Da würde ich noch Frage vier drunter nehmen: in welchen kulturellen Prozessen ... Das sind sozial-kulturelle Prozesse, das ist klar, denn es bedarf dazu immer auch der informativen Infrastruktur, der Ermutigung, des Austausches, des akzeptierten Milieus und so weiter. Im übrigen sonst muss ich passen - also in der Jugendkultur kenne ich mich nicht aus, in sozialen Milieus habe ich auch nur einen begrenzten Zugang, und mich auch in letzter Zeit häufiger mit den Problemen der Nord-Süd-Beziehungen beschäftigt. Dann wird mit Frage fünf zum internationalen Feld der Auseinandersetzungen Gefahren und Gefährdungen - und da denke ich, sind das, was derzeit in der UNESCO diskutiert wird, wo es darum geht, eine Konvention der UNESCO zum Schutze der kulturellen Vielfalt - die so genannte Vielfaltsdiskussion - um so eine Konvention zu entwickeln, halte ich das für eines der für mich ganz wichtigen die Dinge, nicht nur international, sondern auch rückwirkend wieder darauf, zu erkennen, dass kulturelle Vielfalt ja wesentlich mehr ist als nur ästhetisch orientierte Bereicherung, sondern kulturelle Vielfalt ist eine angesichts der Unwägbarkeiten der Zukunft unverzichtbare Ressource. Das ist die Formel des Berichtes der Weltkommission für Kultur und Entwicklung. Das würde ich denn schon übertragen auf die kulturellen Vielfalt innerhalb unseres Landes, kulturelle Vielfalt auch mit den Migranten, die uns erstens ganz andere Lebensweisen zeigen, die uns (oder wo uns im Museum, wie hier im Museum der Weltkulturen, gezeigt werden könnte), dass Menschen auch ganz anders leben können und dabei glücklich sein können, ganz andere Chancen bestehen (kulturelle Vielfalt als Ressource!) Und drittens oder schließlich der Hinweis darauf, dass verloren gegangene Sozialtechniken, verloren gegangene handwerkliche Techniken unter Umständen in Zusammenhang mit ökologischen Prozesse, im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung wieder interessant werden könnten und deswegen (von uns?) vorgehalten werden müssen. Deswegen wollte ich eigentlich von da aus noch einmal zur Frage vier zurückkommen - diese Prozesse, auf die es heute ankäme - wären eben im Rahmen dieses Empowerment eben solche Prozesse, die es vielleicht möglich machen würden mit etwas weniger Keynesianismus in einem Land - wie man Oskar Lafontaines Vorstellung genannt hat - zurechtzukommen, denn mit der Abschottung kommt man nicht mehr weit heute. Sondern man muss die eigenen Kräfte, nicht nur die wirtschaftlichen, nicht nur die ökonomischen Kräfte sondern die sozialen Kräfte – dazu gehört Solidarität, die Kräfte der Selbsthilfe, wecken. Die Schlussfrage, was ist wichtiger als Antworten auf die Fragen - das ist sehr schön - Lebensqualität! Und ich wünsche mir eigentlich, dass die Politik nicht Wachstum in den Vordergrund stellt und hofft, dass über Wachstum Arbeitsplätze und so weiter, Lebensqualität generiert werden, sondern das die Politik Lebensqualität in den Vordergrund stellt und sie überlegt, was es denn bedeutet, zur Lebensqualität der Menschen beizutragen. In dem kleinen Himalaya-Königreich Bhutan - keine Demokratie aber auch kein autoritärer Staat - in diesem kleinen die Himalaya-Staat sagt der König, mir ist das Buttowohlbefinden meines Volkes wichtiger als das Bruttosozialprodukt. Alf Lüdtke (18. Juli 2005) 
Prof. Alf Lüdtke (Göttingen) im Interview Erstens: Ich bin unsicher, wie weit man von dem Gesamtzusammenhang so homogen sprechen kann und denke, dass die regionalen Differenzen, zum Teil natürlich auch die Differenzen Stadt-Land, sich nicht nur verstärken. Sie sind auch keine neuen Differenzen, sie sind in der DDR zum Teil verändert worden, aber sind natürlich auch nicht DDR-made gewesen, also zwischen Nord und Süd, zwischen den Landregionen, dem „platten Land“, um es preußisch zu sagen, und den kleineren und größeren Städten, vielleicht vor allem auch den kleinen Städten, also die ja so eine besondere Zwischenzone markieren und die in der DDR vielleicht in besonderer Weise in den letzten zehn Jahren mehr und mehr abgemeldet und „vergraut“ waren, aber da gibt es sicherlich Veränderungen, aber ob sie – das ist mehr natürlich das Straßenbild, das sind die Pflasterungs- und Straßenlaternenaktionen – wie weit die da sehr viel verändert haben...? Es gibt nach wie vor Wanderungsbewegungen in die Städte, es gibt nach wie vor Wanderungsbewegungen, die inzwischen von Ost nach West gehen. Das hat es in der DDR in anderer Himmelsrichtung auch gegeben, also ich frage mich, ob da so sehr viel an Veränderung zu beobachten ist. Zweitens: Da gab es sicher was, aber im Hinblick auf Ost-West gab es eigentlich fast nichts, und das finde ich nicht völlig enttäuschend - ja, in gewisser Weise finde ich es schon enttäuschend, andererseits aber nicht unerwartet, denn so, wie die Ungleichheiten im Hinblick auf die ökonomische Dimension von Kultur, also Kultur jetzt im Sinne von Lebensweise, verteilt sind, kann das nicht völlig überraschen. Wobei es da auch keine Schwarz-Weiß-Situation gibt, es gibt zum Teil mehr Leute, die zumindest mal hinfahren oder hingefahren sind, als das vor zehn Jahren vielleicht noch zu vermuten war. Auch da möchte ich mich hüten vor einem zu eindeutigen Es-ist-nur-so-und nie-Anders. Aber im Sinne eines klaren Trends oder einer bestimmten Entwicklung, die man sehr eindeutig benennen könnte, denke ich, würde ich eher Fehlanzeige vermelden. Drittens: Ja, ´94 hatte ich ja gesagt, dass es aus meiner Sicht sehr langfristige sowohl Unterschiede wie (wenn überhaupt) Veränderungen sein werden und hatte versucht, die Analogie mit der Differenz zwischen Nord- und Südstaaten in den USA zu versuchen - in dem Sinne, dass einerseits Prozesse sind, die nicht nur eine, sondern mehrere Generationen umfassen und vor allem auch Differenzen, die in immer neuer Weise bearbeitet, aber dadurch nicht eliminiert werden. Differenzen, die auf der einen Seite: das wäre dann die der ehemaligen DDR, der ostdeutschen Länder und Regionen, und vor allem natürlich der Menschen, eine Wahrnehmung von Verlust, von Niederlage transportieren; es sind aber auch Fixierungen, die damit zu tun haben. Und da wäre mir der USA-Vergleich nach wie vor wichtig, nämlich: Inwieweit gib es Selbst-Victimisierungen, also Selbstzuschreibungen als Besiegte, als diejenigen, die eine Niederlage erlitten hätten oder denen man sie zugefügt hätte, die ungerecht behandelt worden seien. Gibt es also neben den Beobachtungen und neben den Bewertungen, die ich zum Teil sehr teilen würde, ein Surplus, der so etwas wie eine Selbst-Victimisierung sein könnte? Das wäre ein Punkt, den im Hinblick auf diese Situation in den USA für sehr gravierend halte, vor allem in seinen langfristigen Folgen. Und mir scheint, auch wenn das vielleicht nur zum Teil das Problem abdeckt, dass etwa die Ostalgiewelle vor zwei, drei Jahren, die ja da erst den medialen Höhepunkt erreichte oder den massenmedialen (die mir aber weiterhin nicht vorbei zu sein scheint: mein Beobachtungsfeld ist ja mehr ein Teil von Thüringen) - dass genau diese Ostalgie ein Anzeichen dafür ist. Da gibt es natürlich dann mediale Verstärker wie ein Teil des Programms des MDR, aber ich glaube nicht, dass es eine mediale Manipulation ist, ich denke, das sind Wahrnehmungen „on the ground“. Viertens: Ja, was ich ausgeblendet hatte, was aber für einen weiten Kulturbegriff eine Unmöglichkeit ist, das ist natürlich das Verständnis und die Erfahrung von Arbeit, Erwerbsarbeit, aber auch andere Formen von Arbeit, und ich denke, dass der Bruch in der Tat so massiv ist, wie er ja auch von vielen zumindest registriert wird. Die Bearbeitungsformen sind zum Teil, denke ich, mit der Selbst-Victimisierung angedeutet, zum Teil aber auch gehen sie so in eine stumme Individualisierung oder, ich weiß nicht, ob das Wort Privatisierung wichtig ist, jedenfalls sieht man und hört man nach außen nicht so sehr viel, was die Sache nicht unbedingt besser macht. Da hätte ich ein relativ großes Fragezeichen. Und die Wahlergebnisse oder auch Beteiligungen an Gruppen an irgendwelchen Rändern finde ich dabei auch kein besonders triftiges Auskunftsmittel. Also da ist glaube ich etwas, was ganz wesentlich ist. Und das gehört natürlich in diesen Zusammenhang mit hinein – auf keinen Fall habe ich eine Patentantwort, noch nicht einmal eine eindeutige Wahrnehmung. Fünftens: Ja, zunächst denke ich, es ist entscheidend, sich dessen bewusst zu werden, d.h. die Praktiken und Strategien, die da angewandt werden, zu erkennen und sich dem nicht einfach auszusetzen oder auszuliefern – auszusetzen vielleicht schon, aber nicht auszuliefern. Also es gibt natürlich auch keine schnellen Gegenmöglichkeiten, man muss eben sehen, dass auch Gegenbewegungen, etwa im Bereich der World Music die authentischen und narrativen und wie auch immer Melodien, Gesänge und Gruppen sich natürlich ihrerseits in einem Wirkungszusammenhang bewegen, dass Authentizität eben auch wiederum eine produzierte ist. Da gibt es keine einfachen Lösungen. Mir scheint wichtig das man versucht, Distanz zu gewinnen zu dem, was die Attraktion von sinnlich Vermitteltem bereitstellt – sei es Musik, sei es Bild und Ton oder die Verbindung von beidem in Film und Video - also Techniken und Praktiken der Distanzierung zu entwickeln. Das geht immer nur sehr konkret, zum Teil dann auch vielleicht sehr punktuell. Da gibt es gewiss keine globale Gegenbewegung, jedenfalls sehe ich sie nicht. Sechstens: Ja, das wäre also das, was ich schon gesagt habe: die Arbeit in der DDR. Jürgen Marten (10. August 2005) 
Dr. Jürgen Marten (Berlin)im Interview Ich habe mir meine kleine Stellungnahme von vor zehn Jahren noch einmal angesehen und festgestellt, dass die meisten Überlegungen, die damals angestellt worden sind, nicht nur nicht zutreffen, sondern dass sich möglicherweise in bestimmten Tendenzen sogar negativ entwickelt haben. Ich hatte ja damals angemerkt, dass Kultur in den Lebenszusammenhängen der Menschen und bezogen auf die individuelle und auf die gesellschaftliche Reproduktion keine so große Rolle mehr spielt. Das erweist sich als zutreffend. Denn erstens ist ja folgende als Tendenz festzustellen, dass auf der einen Seite durch eine zunehmende Kommerzialisierung von Kultur und durch ein riesiges Angebot kultureller Güter – wie auch immer man sie bewerten mag – die Kompetenz zum Auswählen gar nicht mehr vorhanden ist. Es ist doch mehr eine Eventkultur geworden, mehr die Beliebigkeit. Wenn man heute in einen Buchladen geht und nicht speziell etwas sucht, ist man nicht zum Buchkauf angeregt, sondern eigentlich desorientiert. Und zunehmend findet über diese Dinge, über kulturelle Sachverhalte und Sachen, auch keine wirkliche gesellschaftliche Kommunikation und auch kein Diskurs mehr statt. Andererseits ist Kultur natürlich in immer stärkerem Maße primär verbunden mit fiskalischen Überlegungen. Es ist also nicht so sehr die Frage, wie sie eingeordnet ist in die Lebenszusammenhänge der Menschen, sondern was sie für Geld kostet, und es wird, was Kulturpolitik betrifft, kaum noch über Inhalte diskutiert, sondern immer nur noch vor allem darüber darum, was es kostet wie und von wem finanziert werden kann. Das betrifft natürlich ganz besonders die neuen Bundesländer, also die Kultur im Osten, weil doch in stärkerem Maße, als das am Anfang auch unter dem Gesichtspunkt der kulturellen Substanzerhaltung noch gesehen worden ist, doch kulturelle Einrichtungen und kulturelle Institutionen bedroht sind in ihrer Existenz. Wenngleich sie zu einem großen Teil noch existieren erhalten sind, sind sie kaum noch in der Lage, in den engen finanziellen Rahmenbedingungen wirkungsvoll zu arbeiten. Und was wohl ganz entscheidend ist, die Leute, ein Großteil der Menschen ist so stark mit existentiellen Problemen beschäftigt. Wenn man beispielsweise also die Uckermark nimmt, wo fast 30 Prozent Arbeitslose sind, da wird der kulturelle Diskurs vor allem darüber geführt, welche Sozialmaßnahmen für einen zutreffen und nicht welche kulturellen Maßnahmen. Also insgesamt ist es schon so, dass das, was wir an Idealvorstellungen über Kultur hatten, dass Kultur ein wirklicher Bestandteil des Lebens ist und dass Kultur auch der Bereich ist, wo sich Gesellschaft erweitert reproduziert und auch die Individuen, dass das überhaupt nur noch in sehr eingeschränktem Maße vorhanden ist. Es gibt aber wahrscheinlich mit Sicherheit unter den schwierigen gesellschaftlichen Bedingungen, denen wir ausgesetzt sind und hinsichtlich der Aufgaben, die vor uns stehen, gar keine andere Chance, als diesen Bereichen wieder größere Aufmerksamkeit zu widmen. Denn nur selbstbewusste Menschen – und Kultur ist eine notwendige Voraussetzung dafür - sind in der Lage, auch eine Gesellschaft zu gestalten, die möglicherweise bessere Lebensverhältnisse bietet, als sie jetzt für die Mehrheit existieren. Dieter Rink (11. Juli 2005) 
Dr. Dieter Rink (Leipzig) im Interview Zur ersten Frage - was sind die wichtigsten kulturellen Wandlungen in Ostdeutschland? Eine sehr schwierige Frage, die habe ich wochenlang in mir hin und her gewälzt und eine Liste gemacht, das ist eigentlich wichtig und das ist noch wichtiger. Dann habe ich das völlig verworfen und mir überlegt, dass ich mich einfach auf ein Feld konzentriere, von dem ich etwas mehr weiß, als jetzt so einen Gesamtüberblick zu machen. Das sind nämlich Jugendkulturen. Damit beschäftige ich mich schon seit über zehn Jahren und denke, dass in diesem Feld auch ganz wesentliche Wandlungen vor sich gegangen sind. Jugendkulturen funktionieren in einer Gesellschaft ja auch als Seismographen und reagieren sensibler und schneller, aber eben häufig auch heftiger. Ich glaube, dass man insofern von den Jugendkulturen im Osten einiges ablesen kann in Bezug auf die ganze ostdeutsche Gesellschaft. Zum einen haben sich Jugendkulturen nach 1989 in Ostdeutschland unglaublich ausgebreitet und dabei sehr stark ausdifferenziert. In der DDR gab es eigentlich nur eine Minderheit an Jugendlichen, die überhaupt in einer Jugendkultur aktiv waren. Die kann man eigentlich auf einige wenige Prozent begrenzen. Also die Stasi hat Ende der 80er Jahre beispielsweise noch die Punks in Berlin, in Leipzig und in Dresden gezählt oder auch die Skinheads. Das war damals noch möglich, weil das eine überschaubare Zahl war. Das wäre in den Neunziger Jahren so gar nicht mehr möglich gewesen, mal abgesehen davon, dass es niemanden mehr gab, der das so genau wissen wollte. Das heißt, wir haben es jetzt mit einer großen Zahl von Jugendlichen zu tun, die mittlerweile von den Jugendkulturen erfasst werden und können sogar sagen, dass die Mehrheit der Jugendlichen dort aktiv ist. Und wir haben es in den Neunziger Jahren mit einer besonderen Situation in Ostdeutschland zu tun. Diese Situation gleicht Grunde der von Migrantenkulturen, obwohl ja die ostdeutsche Gesellschaft nicht gewandert ist. Aber die ostdeutschen Jugendlichen befinden sich praktisch zwischen der Abreisegesellschaft der DDR und der Ankunftsgesellschaft Bundesrepublik. Sie haben mit ähnlichen Problemen zu kämpfen, wie etwa türkische Jugendliche in Berlin oder arabische in Marseille. Aber: ihnen ist ein Weg versperrt, den diese Jugendlichen dann häufig gehen, sie können sich nicht auf eine ethnische Gemeinschaft beziehen, weil sie keine andere Hautfarbe haben bzw. keine andere Sprache sprechen. Wenn sie sich aber auf ihre „ethnische Besonderheit“ beziehen, dann landen sie ganz schnell beim Nationalismus und bei rechten Positionen. Von daher erklärt sich auch, warum sich in Ostdeutschland in den Neunziger Jahren rechtsradikale Jugendkulturen als dominante Jugendkulturen ausbreiten konnten. Sie sind außerdem in viele andere Jugendkulturen, wie etwa Grufties oder Heavy Metal oder auch mittlerweile in die Rockszene rein gekommen. Deswegen haben sich diese Jugendkulturen in den Neunziger Jahren auch so stark politisch aufgeladen. Die Jugendkulturen, die sich auf die DDR stärker rückbezogen haben, sind zu linken oder linksautonomen Kulturen geworden, die, die diese ethnische Richtung gegangen sind, sind im Prinzip Rechte geworden. Und diese beiden Gruppierungen haben sich über weite Strecken, fast die ganze Neunziger Jahre hindurch, natürlich diametral gegenüber gestanden. Und deswegen durchzieht die Geschichte der ostdeutschen Jugendkulturen in den Neunzigern auch eine Geschichte von Auseinandersetzungen, von Kämpfen bis hinzu Straßenschlachten. Das ist selbst noch in der Gegenwart zu spüren. Das Feld der Jugendkulturen ist zugleich das Feld, wo sich die West-Ost-Angleichung abspielt. Also viele dieser Jugendkulturen lehnen sich natürlich an westlichem Muster an, an westdeutsche, natürlich auch britische und andere, amerikanische. Und über diese Jugendkulturen erfolgt für die Jugendlichen dann über die Pubertät und über die Adoleszenz getragen, letztendlich der Einstieg in die westliche Konsumkultur, in neue Lebensstile. Und das ist auch der Weg, über den hier in Ostdeutschland die Individualisierung und vor allem die Pluralisierung der Lebensstile erfolgt. Die Ausdifferenzierung der Lebenswelten ist etwas, was sehr stark von Jugendlichen oder jetzt jungen Erwachsenen getragen worden ist und wobei die Jugendkulturen eine Pionierrolle gespielt haben. Zweitens: Zum kulturellen Wandel in westlichen Bundesländern. Ich denke, dass es den auch dort gibt, allerdings ist der dort nicht so deutlich ausgeprägt, wie das in Ostdeutschland der Fall ist. Das ist auch völlig klar, dort gab es ja schon gravierende kulturelle Wandlungsprozesse in den 60er und 70er Jahren. Dort haben wir es eher mit einer Kontinuität zu tun, nicht mit einem gesellschaftlichen Umbruch wie in Ostdeutschland. Was man beobachten kann, wenn ich jetzt bei dem Feld der Jugendkultur bleibe, dass auch dort sich eine weitere Ausdifferenzierung abgespielt hat und dann allerdings eher eine Entpolitisierung. Das ist in diesem Feld ein ziemlich gravierender Unterschied zum Osten. Und was man auch noch beobachten kann, was sich eigentlich durchgezogen hat, ist so eine gewisse Abschottung oder auch eine Selbststilisierung. Die Abschottung und Abgrenzung erfolgt gegenüber dem Osten und ist auch eine Selbststilisierung, die so ein bisschen auch dem Anciennitätsprinzip folgt. Insgesamt haben wir im Westen schon andere Werte und das Feld der Jugendkulturen ist ganz anders strukturiert. Dort spielen die Rechten keine große Rolle, dafür gibt es viel mehr ethnische Subkulturen und die Popszenen sind viel distinktiver als im Osten. Drittens - stehen sie zu ihrer Auffassung von 1994 - da kann ich mich voll an das anschließen, was Michael Hofmann schon gesagt hat. Ich stehe voll zu unserer Schlussformulierung, dass sich die Ostdeutschen nicht ändern müssen, dass sie von ihrer mentalen Ausstattung eigentlich ganz gut gerüstet sind für die westdeutsche Gesellschaft bzw. sie von der nicht so viel erwarten brauchen, dass sie sich dafür ändern müssten. Viertens: Die vierte Frage bezieht sich auf interessante oder innovative kulturelle Prozesse und Szenen. Hier will ich zum einen wiederum auf die Jugendkulturen zurückkommen, die ja ständig für kulturelle Innovationen sorgen, auch wenn sich das ein bisschen abgeschwächt hat, wie es scheint. Ich denke, dass die Aufmerksamkeit für die rechten bzw. neonationalsozialistischen Szenen größer sein sollte. Sie waren in den letzten Jahren innovativer, als man denkt und stellen meines Erachtens sowohl für die gesamte politische Kultur, aber auch für die Kultur im engeren Sinne in Ostdeutschland eine große Bedeutung haben oder vielmehr sogar eine große Gefahr darstellen. Es gibt viele ländliche oder auch kleinstädtische Räume in Ostdeutschland, wo keine andere Kultur als die der Rechten stattfindet. Vor allem Jugendliche haben häufig keine andere Wahl und können dem kaum ausweichen. Das zweite Augenmerk würde ich auf kleinstädtische und ländliche Räume in peripheren Regionen richten, wo die Bevölkerung sehr stark schrumpft, wo praktisch keine Wirtschaft mehr da ist und wo es ein Problem ist, überhaupt noch Kultur aufrecht zu erhalten. Hier sollten die Beispiele, die es schon gibt, wo also Formen von selbst organisierter Kultur stattfinden, viel mehr untersucht und auch viel mehr popularisiert werden, um überhaupt noch irgend eine Chance für diese Regionen aufrecht zu erhalten. Hier brauchen wir noch viele Innovationen, auch organisatorischer bzw. finanzieller Art, um diesen Prozess in eine nachhaltige Richtung zu lenken. Fünftens: Und schließlich eine letzte Frage, die nach den Internationalen Gefahren und Chancen - dazu kann ich eigentlich recht wenig sagen. Internationale Chancen sehe ich eher in dem Prozess der Europäisierung, also der europäischen Integration, dass hier auch die Regionen, die in Ostdeutschland schrumpfen, sich vergleichen und austauschen können mit anderen Regionen, wo das auch der Fall ist. Was wir in einem vergleichenden Projekt am Beispiel von Halle/Leipzig und Manchester/Liverpool untersuchen, die in diesem Prozess schon wesentlich weiter sind und wo Ostdeutschland von diesen Regionen lernen kann bzw. in einigen Bereichen auch schon voraus ist, sodass möglicherweise solche Regionen auch von uns lernen können. Sechstens: Schließlich als letzte Frage: was ist wichtiger als Antworten auf diese Fragen - das sind einfach ja Beispiele, es selber zu tun, Kultur selber zu organisieren, auf die Beine zu stellen und damit auch ein Beispiel für andere zu geben. Kristina Volke (3. Oktober 2005) 
Kristina Volke (Berlin) im Interview Erstens: Mit dem weiten Kulturbegriff gemessen, ist der gesellschaftliche Umbruch selbst die größte kulturelle Veränderung, denn mit ihm haben sich Codes, Werte, Strukturen, Selbst- und Fremdbilder etc. wenn nicht aufgelöst so doch verschoben. Unter ihnen zu hierarchisieren scheint mir nicht sinnvoll. Im engeren kulturellen Sinne, also in Bezug auf Kunst und Kultur sehe ich ebenso viele verschiedene und gleichwertige Veränderungen, die vom Umbau der Kulturlandschaft in ein föderales System, den Wandel einer staatlich gesteuerten Kulturideologie in einen Mix aus freier Marktwirtschaft und eben jenem umgebauten System öffentlicher Kulturförderung bis zur Ausbildung völlig neuer Szenen reichen. Mich persönlich interessiert bei all diesen Veränderungen am meisten die Frage danach, was Kunst und Kultur für die Gesellschaft bedeuten, und ich glaube, dass man sie nicht für wichtig genug erachten kann: Unterstanden Kunst und Kultur in der DDR einer extremen ideologischen Kontrolle durch den Staat, garantiert die Bundesrepublik Kunst und Kultur grundgesetzlich die Freiheit – und hält sich auch daran. Auf der Kehrseite kann man sehen, dass Kunst und Kultur in der DDR aber auch eine größere gesellschaftliche Relevanz hatten. Kunst bedeutete etwas. Man redete über die gezeigten und die nicht gezeigten Gemälde der großen Kunstausstellungen, man hörte in den klassischen Theatertexten die Übertragbarkeit auf das Jetzt, man las in den neuen Büchern zwischen den Zeilen von dem, was eigentlich ungesagt bleiben musste. Ein abstraktes Bild auf der Kunstausstellung konnte unglaubliches auslösen. Ein gegenständliches selbstverständlich auch. Die Bedeutung von Kunst, die sich auf breite Bevölkerungsschichten erstreckte, ist heute kaum noch nachzuvollziehen. Ich nenne das den „Gesprächsraum Kunst“, der sich zunächst eher unbemerkt neben der bzw. durch die hohe Ideologisierung gebildet hatte – und der mit dem „Alles ist möglich“ der bundesrepublikanischen Kunstfreiheit sofort unterging. Und nun, so beobachte ich seit einiger Zeit, verändert wieder aufscheint – von Zurückkehren sollte man vielleicht noch nicht sprechen. Vor allem in den ländlichen, von Abwanderung und massenhafter Arbeitslosigkeit betroffenen Gebieten Ostdeutschlands kann man beobachten, dass Kunst, besonders das Theater, wenn es für die Leute vor Ort gemacht wird, wieder enorm an Bedeutung gewinnt. Und Gesprächsräume eröffnet, die sonst fehlen. Diese Wiederaneignung der Kultur ist vielleicht nicht die wichtigste aber eine der interessantesten kulturellen Veränderungen in Ostdeutschland. Zweitens: Selbstverständlich gab es auch in den alten Bundesländern einen Wandel. Dazu gehört als zentraler Prozess die Suche nach Konzepten, die nach dem Leitspruch „Kultur für alle“ kommen und mit den längst angebrochenen Zeiten leerer öffentlicher Kassen kompatibel sind. Interessant ist dabei zum Beispiel das Thema „kulturelle Grundversorgung“, denn hier wird diskutiert, was der Staat als öffentliches Gut Kultur vorhalten muss, um allen einen Zugang zur „Ressource Kultur“ zu ermöglichen. Dieser Versuch einer Neudefinition eines urdemokratischen Kulturverständnisses ist schwierig, denn es geht plötzlich darum festzulegen, welche Kultur man unbedingt erhalten muss und welche – am ehesten - verzichtbar scheint bzw. als Luxus gelten könnte, so dass man sie zumindest in größeren Anteilen den privaten Geldbeuteln überlassen kann. Bisher gibt es hier meines Wissens keine ernstzunehmenden Angebote, denn sobald einer vorschlägt, dieser Luxus könne z.B. die Oper sein, zählt ein anderer die (sicherlich unleugbaren) Vorteile musikalischer Bildung auf und verweist auf die Werte des musikalischen Live-Erlebnisses seit dem Barock. Oder so. Leider führt die Frage wenn sie so gestellt wird, unweigerlich dazu, dass kulturelle Szenen gegeneinander ausgespielt werden oder sie es vorauseilend gleich selber tun. Trotzdem ist es natürlich nötig, das aus Wohlstandszeiten existierende Kultursystem umzubauen. Und dazu gehört auch ein Paradigmenwechsel, in dem der Staat danach fragen können muss, was ihm die von ihm so großzügig geförderte Kultur eigentlich bringt. Solche Konzepte werden langsam unter dem label „Evaluation in der Kulturförderung“ diskutiert. Dabei geht es nicht um Aufhebung der Kunstfreiheit, sondern um eine Art Effektivitätskontrolle. Öffentliche Hand fördert Kultur, weil sie öffentliches Gut ist. Nur in dieser Gleichung macht öffentliche Kulturförderung Sinn. In Zeiten mit viel Geld ist diese Kontrolle nicht nötig, denn dann kann mehr oder weniger jede Kultur gefördert werden. Wenn sich dies ändert – wie in den letzten Jahren geschehen - muss es Kriterien geben zu unterscheiden. Hier schließt sich der Kreis zur kulturellen Grundversorgung. Das Ganze ist natürlich ein empfindliches Thema, bei dem nicht nur der Vorwurf der Indoktrination und Funktionalisierung nahe liegt, sondern auch eine reale Gefahr dafür besteht. Und trotzdem ist es notwendig, die Fragen anzugehen. Interessant ist m. E., dass hier Ostdeutschland eine Vorreiterrolle übernimmt und vorführt, wie es gehen kann. Drittens: Das wüsste ich auch gern. Viertens: Aufmerksamkeit gelten sollte der Repolitisierung der Kunst und Osteuropas eigenen Paradigmen und z. T. kulturzentrierte Wege der Transformation. Von dort sind auch kulturelle Innovationen zu erwarten. Dasselbe gilt für Kulturakteure in den ländlichen Gebieten Ostdeutschlands, die an die Stelle der sukzessiv abgebauten öffentlichen Räume treten. Rudolf Woderich (10. August 2005) 
Dr. Rudolf Woderich (Berlin) im Interview Erstens: Die wichtigste kulturelle Veränderung seit 1990 sehe ich im abrupten Wandel relativ stabiler Standards der Industriegesellschaft in ihrer staatssozialistischen Variante, insbesondere der Orientierung an den industriegesellschaftlichen Erwerbs- bzw. Lebensverlaufsmustern. Konzentrierten Ausdruck findet dieses Phänomen ja in der seit 15 Jahren andauernden Massenarbeitslosigkeit, die eben nicht vorrangig durch konjunkturelle bzw. temporäre Wachstumsschwächen der ostdeutschen Wirtschaft bedingt ist, sondern auf einen grundlegenden Strukturwandel von Wirtschaft und Gesellschaft verweist. Vor allem deshalb mussten arbeitsmarktpolitische Maßnahmen die zunächst intendierten Ziele verfehlen. - Erfolgreich praktiziert wurde dann aber eine „innovative Politik“ sozialer Befriedung: Sie war darauf gerichtet, den Arbeitsmarkt schrittweise zu bereinigen, ihm qualifizierte, jedoch „überschüssige“ Erwerbspotenziale zu entziehen. Zweitens: Ein vergleichbarer kultureller Wandel in den „alten Bundesländern“ ist m. E. im Verlaufe der letzten zehn, fünfzehn Jahre nicht nachweisbar. Erkennbar sind bestenfalls Ansatzpunkte in der Weise, dass sich das sogenannte postmoderne Erlebnisparadigma abschwächt, was einen neuen kulturellen Pradigmenwechsel signalisieren könnte. Drittens: Ich gehe davon aus, dass ich meinen Beitrag zur Kulturenquete von 1994 in den Grundzügen aufrecht halten kann. Es ging damals um einige Aspekte der Konstruktion ostdeutscher Identitäten. Allerdings hatte ich durchaus erwartet, dass sich ostdeutsche Identitäten stärker in der Öffentlichkeit, diskursiv bzw. in spezifisch kulturell reflektierten Formen geltend machen würden. Das ist offensichtlich nicht oder nur marginal der Fall. Möglicherweise spielen dabei begrenzte Zugänge zu entsprechenden Öffentlichkeiten eine Rolle. - Zu ergänzen wäre, dass auch die etablierte (westdeutsche) soziologische Umfrageforschung, wenngleich relativ spät, das Phänomen ostdeutscher Identitätsbildung diagnostizierte und als legitim anerkannt hatte (H. Meulemann 1998: „Die ostdeutsche Identität ist möglich geworden, weil die DDR gescheitert ist.“). Künftig zu erwarten sind m.E. stärker regionale Differenzierungen in Ostdeutschland, Identifikationsprozesse, die auf verschiedenen Ebenen zu erwarten sind und einander überlagern werden. Viertens: Die nächste Frage zielt auf kulturelle Innovationen in Ostdeutschland, also auf Themenfelder, die interessant sein könnten und perspektivisch oder aktuell ausführlicher untersucht und diskutiert werden sollten. Da es gewiss eine Vielzahl relevanter Themen gibt, möchte ich mich auf einen vielversprechenden Ansatz konzentrieren, der m. E. weitergeführt werden sollte: nämlich Idee und Konzept des Projekts „Labor Ostdeutschland. Kulturelle Praxis im gesellschaftlichen Wandel“ (gefördert von der Kulturstiftung des Bundes; Hrsg. der Publikation: K. Volke/I. Dietzsch), dessen Publikationsform eine beachtliche Resonanz gefunden hatte. Mir geht es dabei insbesondere um die Vielfalt kreativer Projekte, um neue kulturelle Praxen und Initiativen, die noch viel zu wenig bekannt sind und in regionalpolitische Entwicklungskonzepte zumeist unzureichend eingebunden werden. Dazu gehören auch jene kulturell-künstlerische Aktivitäten von „Raumpionieren“ in peripheren Räumen und Regionen, die auf diese Weise vermeintlich „leere Räume“ neu deuten, entdecken, in Wert setzen und für alternative Verwendungen kolonisieren. Derartige kulturelle Innovationen, die immer zugleich mit neuen Lebenspraxen und Lebensmustern verbunden sind, werden in der Öffentlichkeit erst schwach kommuniziert, sind aber hochrelevant insbesondere in den Prozessen des Übergangs zu einer auf Wissen basierten Dienstleistungsgesellschaft. Einen Grund, weshalb derartige Innovationen, neue Erwerbsmuster, Lebensstile und personale Identitäten insgesamt unterschätzt werden, sehe ich in einem sehr verengten Innovationsverständnis, das zumeist an Technologien ausgerichtet bleibt. Auch diesbezüglich wirken verfestigte Denk- und Kulturmuster nach, die tief in der Industriegesellschaft verwurzelt sind. Fünftens: Ein weiterer Aspekt betrifft das Feld kultureller Auseinandersetzungen. Ein komplexes Problemfeld, das künftig noch intensiver die Diskurse bestimmen und neue Herausforderungen gerade an kulturwissenschaftliche Forschungen stellen wird. Ohne die schon jetzt erkennbaren und praktizierten Chancen interkultureller Kommunikation und wechselseitiger Lernprozesse zu verkennen: Derzeit sehe ich tatsächlich erhebliche Gefährdungen, die von neuen kulturellen Fundamentalismen ausgehen als Reaktionen auf die weltweite Dynamik von Modernisierungs- und Wandlungsprozessen, die zugleich mit scharfen Ungleichheiten und Disparitäten verbunden sind. Aktuell beobachtbare Phänomene veranlassen zu größter Besorgnis und erfordern allererst ein internationales Politik-und Konfliktmanagement, um Katastrophen zu vermeiden, deren Ausmaß die Zerstörungen des 20. Jahrhunderts übertreffen könnten. Kultur- und Politikkonzepte (u.a. sustainable development) sind gefragt, die darauf gerichtet sind, allen Erdbewohnern ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Das kann schritttweise nur gelingen, wenn auch der tradierte westliche Wertehorizont auf seine kulturellen Fundamentalismen überprüft wird. Lebensweisen müssen hervorgebracht werden, die im Kantschen Sinne als ein Handeln gelten können, das grundsätzlich für alle Menschen gleichermaßen möglich sein muss, ohne die natürlichen Ressourcen und Gleichgewichte dieser Welt irreversibel zu zerstören. Abgesehen davon, sind Erscheinungen eines kulturellen Fundamentalismus zunehmend auch in den europäischen Gesellschaften des Westens zu beobachten. Soziologen verweisen seit geraumer Zeit auf die schleichende Tendenz zur Kulturalisierung sozialer und politischer Sachverhalte, die mit der europäischen Integration einhergeht. Insbesondere in peripheren Regionen werden Räume sakralisiert, entstehen neue Formen einer kulturell aufgeladenen separatistischen Identität. - Offensichtlich kann die Europäische Integrationsidee nicht dauerhaft durch ökonomische Argumente und distikte Interessen von Eliten (sh. Verfassungsdebatte) legitimiert werden. - Jean Monnet, einer der Väter der modernen europäischen Idee, soll am Ende seines Lebens bekannt haben: Eigentlich müsste man von vorn beginnen und zwar beim dem Aufbau der Kultur. Es folgen Kommentare zur Enquete von Harald Dehne, Isolde Dietrich, Gerlinde Irmscher und Dietrich Mühlberg Harald Dehne 
Wertewandel Die Antworten der Enquête bestätigen den Eindruck, dass der Wertewandel den Osten zwar unvorbereitet, gravierend und teilweise früher als in den alten Bundesländern traf, dass die Wandlungen grundsätzlich aber die Gesellschaften in Ost und West betrifft: Alle mussten bzw. müssen sich verändern und neu orientieren. Auffällig ist bei den Einschätzungen der Veränderungen, dass häufig ähnliche Sachverhalte in der einen Wahrnehmung als ein Verlust beklagt, in der anderen Optik jedoch als ein kreatives Handlungspotenzial, als eine Chance und für diejenigen, die die „Zeichen der Zeit“ erkannt haben, auch als ein Vorsprung in der Anpassungsleistung bewertet werden. Methodologisch machen die Äußerungen zum Wertewandel zweierlei deutlich. Erstens: Als grundsätzlich wichtig bei der Beschreibung eines Wertewandels erscheint die klare Benennung von sozialen Bezugspunkten – von welchen sozialen Gruppen oder sozialen Räumen ist denn jeweils die Rede? Zum Beispiel von Generationen („jene interessante Generation, die in der Wendezeit sozialisiert wurde“ – Michael Hofmann), Jugendlichen, Rentnern, Arbeitenden, Arbeitslosen, Industriearbeitern, Angestellten, Selbständigen, Kulturarbeitern usw. Insofern gelten die festgestellten Wandlungen zum Teil nur in einem soziologisch begrenzten Maße. Zweitens: Neben der Bestandsaufnahme, welche kulturellen Werte sich inwiefern gewandelt haben, müssen auch der Mechanismus des Wandels (oder eben auch des Beharrens), sein Tempo, seine Modulationen, sein Ausmaß, seine Gültigkeit usw. mit in den Blick genommen werden, weil Wertvorstellungen ebenso wie Verhaltensmuster, wenn sie sozial vererbt werden, zugleich ein nicht zu unterschätzendes Beharrungsvermögen haben. Folgende Wandlungen sind in den Antworten thematisiert worden. 1. Dass die Ostdeutschen nach der Wende zur neuen Lageeinschätzung gezwungen waren, eine Bilanz ihres bisherigen Lebens zu ziehen hatten und sich neu positionieren mussten, brachte ihnen, neben weniger erfreulichen Zumutungen, auch kulturelle Bereicherungen. Max Fuchs würdigt als ein Ergebnis den Erwerb kultureller Kompetenz, mit dem Kapitalismus, in dem man jetzt lebt, souverän umzugehen. Michael Hofmann sieht beträchtliche „Gewinne an Reflexibilität und Sensibilität“ für die Ostdeutschen; erweitert wurde auch ihr Erfahrungshorizont „durch Reisen, durch Multikulti, durch den Konsum und Wohlstand, die ganze Internationalität, das neue Essen.“ Desgleichen würdigt Thomas Koch den unkomplizierten Zugang zu zeitgenössischen technischen, alltagsrelevanten Errungenschaften und den unkomplizierten Zugang zu Bewegungen, kulturellen Leistungen aus aller Welt als einen Zugewinn für die Ostdeutschen. Dieter Kramer erkennt einen Gewinn in der Selbstverständlichkeit des Umgangs mit dem Fremden, als Selbstverständlichkeit nicht einfach der multikulturellen Gesellschaft, sondern eines städtischen Lebens, das heute mit Selbstverständlichkeit auch multiethnisch, multireligiös usw. ist. 2. Grundsätzlich unterliegen die Lebensläufe der Ostdeutschen einer Neubewertung in der zeitlichen Distanz. Diese Reflexionspraxis geht einher mit einem Wandel in der Erinnerungskultur über die Generationen hinweg (Peter Alheit). Zu den gravierendsten Veränderungen gehört die Aufgabe der einstmaligen Orientierung an dem industriegesellschaftlichen Erwerbs- bzw. Lebensverlaufsmuster (Rudolf Woderich). 3. Dass das Leben in der DDR hinsichtlich Zeit und Tempo geruhsamer als in der BRD gewesen ist, scheint allgemein akzeptiert zu sein. Max Fuchs vermutet, „dass man im Osten Deutschlands einen noch vielleicht sogar humaneren Umgang mit Zeit gepflegt hat“; hier waren weniger Hektik und Druck vorhanden. Ausgehend von dieser vergleichsweise gemütlichen Situation hat der Osten nach der Wende „eine gewaltige kulturelle Beschleunigung“ erlebt (Antonia Grunenberg). 4. Zu den eher negativ bewerteten Folgen des Wertewandels bei den Ostdeutschen gehört das Abhandenkommen von „höheren“ Lebenszielen, das sich in – zumindest so gedachten – Zielprojektionen einer sozial gerechten Gesellschaft ebenso ausdrückte wie im aktiven Hinwirken auf kommende bessere Zeiten. Ein solchermaßen teleologisches Verständnis von Zeit (Albrecht Göschel), die als auf ein (utopisches) Ziel hinlaufend verstanden wurde, ist jetzt obsolet geworden. Dementsprechend spricht Thomas Koch vom „Utopieverlust bei den auf das sozialistische Projekt verpflichteten Minderheiten“. Die „historische Mission“ der Weltveränderung ist mehr oder minder auf der Strecke geblieben, weltweit sei kein wirkliches Agens in Sicht (Helmut Hanke). Beklagt wird, dass die einstige Utopieausrichtung als Handlungsantrieb häufig durch Apathie und Hilflosigkeit, Ohnmacht und Verzweiflung verdrängt worden ist. Für Volker Gransow hat sich in der Ex-DDR „eine alternative Kultur des Pessimismus, der Resignation und der Migration“ herausgebildet. Demgegenüber sieht Thomas Koch auch ein Potenzial, das hoffen lassen kann: Der Osten habe eine welthistorische Mission (die die westlichen und osteuropäischen Eliten nicht mitmachen): dem Vormachtstreben der USA etwas entgegensetzen und die Eigenwertigkeit betonen statt nur die Satellitenrolle zu spielen. 5. Veränderungen sind auch im „Wir-Gefühl“ der Ostdeutschen, die sich plötzlich als eine Minderheit wiederfanden, konstatiert worden. Die Ost-Identität kann als ein Abgrenzungsmerkmal, wie bei Helmut Hanke, gesehen werden, aber auch als ein neues Identitätskonstrukt wie bei Michael Hofmann, der „ein neues Patchwork, eine neue, eher optimistische ostdeutsche Identität“ wahrnimmt. 6. Mehrfach wird der deutliche Verlust der solidarischen Funktion der Gemeinschaft beklagt. Hier reicht die Skala von der Einschätzung, dass Werte wie Solidarität oder Gemeinsinn, selbst Freundschaft, verblassen (Horst Haase) bis zur lapidaren Feststellung einer „Verneinung von zwischenmenschlicher Solidarität“ (Volker Gransow) als Folge der Globalisierung. Nicht minder folgenschwer wirkt sich der Verlust von Selbstwertgefühl, das früher durch die Arbeit und durch vielfache Bestätigung im Kollektiv begründet war, aus. Eine klare Einschätzung trifft Thomas Koch, wenn er von einer Brechung des Selbstbewusstseins der arbeitenden Klassen, der Wiederkehr des Tagelöhners und der Entstehung einer Kategorie sogenannter überflüssiger Menschen spricht. Eine dramatische Wende sieht auch Wolfgang Kaschuba durch den Verlust der „Bestätigung im Kollektiv“, dadurch, dass viele Selbstverständlichkeiten im Arbeitskontext – sehr hohe rituelle Dichte von kleineren Wir-Gruppen, von Ehrungen und Honorierungen – verschwunden sind. Für Alf Lüdtke enthält der Umgang mit der (verlorengegangenen) Erfahrung von Arbeit auf der einen Seite Elemente von „Selbst-Victimisierung“ und „stummer Individualisierung“ (Privatisierung); auf der anderen Seite führen die individuellen Lösungen auch zur Ausbildung der erforderlichen Techniken und Praktiken von Distanzierung gegenüber den neuen sozialen Zumutungen. Diese „neuen Kulturen der Selbstausbeutung“ (Michael Hofmann) bedürfen größerer wissenschaftlicher Aufmerksamkeit. 7. Die bestehenden Systeme sozialer Absicherung haben ihre Gewissheit verloren, für den Osten wie für den Westen. Die soziale Abfederung des Einzelnen durch Staat und Gemeinschaft als ein historisch errungener und gefestigter Wert bröckelt allenthalben. Der zunehmende Verlust des Sozialstaats ist ein durchgehendes Thema. Hätte es für die Alt-Bundesbürger noch eines weiteren Beweises dafür bedurft, dass die althergebrachte Vorstellung, es gäbe einen ständig wachsenden Wohlstand und einen andauernden Fortschritt, längst obsolet geworden war, dann lieferten ihn die neunziger Jahre en masse. Veränderungen werden konstatiert im Hinblick auf die sozial regulierende Funktion des Staates; Stichwörter sind hier Wohlfahrt und Solidargemeinschaft. Hier mussten Erwartungen relativiert bzw. reduziert werden, und zwar sowohl in den neuen als auch in den alten Bundesländern. Sicherlich spielt hier die unterschiedliche Erfahrungsherkunft (sozialistische Fürsorgediktatur bzw. bürgerlicher Sozialstaat) eine entscheidende Rolle. Dass der Staat eine regulierende Institution und die Nation eine Solidargemeinschaft sein sollte – beide Vorstellungen mussten Ostdeutsche aufgeben – wobei Albrecht Göschel hier allerdings ein enormes Beharrungsvermögen in den Erwartungen der Ostdeutschen sieht, die ungebrochen hoffen, dass es mit der Solidargemeinschaft irgendwie so weitergehen werde wie bisher. Ihr gewohntes Anspruchsdenken müssen jedoch angesichts der umfassenden Globalisierung auch die Westdeutschen ablegen (was ihnen nicht minder leicht fällt). Auch ihr Kapitalismus ist „ungemütlicher“ geworden. Max Fuchs betont, dass der Kampf darum gehen müsse, die soziale Abfederung überhaupt noch zu sichern. 8. Durch die Bank wird die Kommerzialisierung des gesamten Lebens im Allgemeinen wie auch des Kulturbereichs im Besonderen beklagt, ein Phänomen, das ost-west-übergreifend zu beobachten ist, wenngleich die neue Orientierung ausschließlich am Geld statt auch an „höheren“ Werten oder Zielen besonders für Ostdeutsche schmerzhaft zu sein scheint. Ostdeutsche sehen sich einem Überangebot an (kommerzialisierter) Kultur gegenüber, wofür die Kompetenz zum Auswählen fehle, und die übermächtige Rolle des Geldes verdecke die Inhalte (Jürgen Marten). Parallel dazu hat sich eine Tendenz zur Verflachung der Inhalte kultureller Kommunikation und medialer Präsentation entwickelt. Spaß haben ist zu einem kulturellen Selbstzweck geworden. Oberflächlichkeit und Flachheit, Event, Aktionismus usw. (Horst Haase) bzw. Banalisierung und Infantilisierung von Inhalten in der kulturellen Kommunikation (Hermann Glaser) bestimmten das Niveau. (Wobei nicht übersehen werden sollte, dass die zunehmende Liebedienerei der Kulturverkäufer gegenüber den potenziellen Konsumenten sich unabhängig von der „Wende“ entwickelt hat.) Spar-Zwänge prägen den Kulturbereich: jetzt herrscht auch in der Kultur „Ökonomismus“ bzw. ein nicht gezähmter Kapitalismus (Hermann Glaser). Für den Osten bedeutet dies, dass die Kultureinrichtungen in ihrer gesellschaftlichen Anerkennung sanken, d.h. praktisch: weniger finanzielle Förderung als in der DDR, d.h. auch weniger Kulturarbeiter, d.h. auch Entwertung von Berufsbildern (Max Fuchs). Hoffnung sieht Dieter Kramer vor allem in der Chance, die sozialen Kräfte der Selbsthilfe zu wecken: investive Sozialpolitik als Form kreativer Selbsthilfe, die neue Ressourcen erschließen kann. 9. Allenthalben positiv bewertet wird die Aufwertung der Provinz als kulturelles Aktionsfeld (Max Fuchs). Auch Rudolf Woderich stellt eine zunehmende Bedeutung von Aktivitäten in peripheren Räumen und Regionen fest. Diese Entwicklung findet erfreulicherweise ost-west-übergreifend statt. Isolde Dietrich 
Kultureller Wandel und Kapitalismuskritik Die Aussagen der Enquête-Teilnehmer – sämtlich der alten und neuen Linken und deren emanzipatorischen Kulturprojekten zugehörig – hinterlassen einen merkwürdigen Eindruck. Offensichtlich ist, dass hier Geschlagene, Ratlose, Verlierer zu Wort kommen bzw. dass in deren Namen gesprochen wird. Es überwiegen beklemmende Szenarien angesichts der Wiedererrichtung der alten politischen und sozialen Ordnung im Osten und der gleichzeitigen Einbeziehung ganz Deutschlands in einen zügellosen globalisierten Kapitalismus. Seltsam an den Wortmeldungen erscheint vor allem zweierlei: Erstens: Die Sicht auf die letzten 100 oder auch nur 50 Jahre. Zweitens: Die Art der Kapitalismuskritik. 1. Anmerkungen zum Rückblick Das 20. Jahrhundert war in Europa und darüber hinaus ein Jahrhundert der Kriege, der politischen und sozialen Katastrophen. Zugleich war dies ein Jahrhundert, in dem die arbeitenden Menschen nicht verarmt und verelendet sind. Sie führen gegenwärtig ein unvergleichlich besseres Leben als die Generationen vor ihnen. 1930 erschien das Buch „Deutschland von unten. Reisen durch die proletarische Provinz“. So etwas müßte man heute wieder schreiben – nur gibt es kein gesellschaftliches Interesse, keinen Auftraggeber dafür. Die Unterschichten sind gegenwärtig kein sozial- oder kulturwissenschaftliches Forschungsfeld, auch kein Gegenstand der Künste. Außer „Armutsberichten“ der Statistiker wird nichts vorgelegt. Würde man die Situation der 33 Mio abhängig Beschäftigten, der 20 Mio Rentner und Pensionäre, der 5 Mio Arbeitslosen, der zahllosen Ich-AG-Gründer mit der von 1930 vergleichen, so würden die enorme Erhöhung des Lebensniveaus, die verbesserte soziale Absicherung, der Zuwachs an Bildung und Kultur sowie die gestiegene Lebenserwartung auffallen. All dies wurde trotz des verlorenen Krieges und seiner Folgen erreicht. Selbst der unverhoffte Anschluss von Millionen ostdeutscher Habenichtse hat diesen Standard nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Die nichtbesitzenden Schichten haben ungeheurer davon profitiert, dass die Kosten für die Reproduktion ihrer Arbeitskraft seit den 50er Jahren explodiert sind. Es ist aber auch daran zu erinnern, dass hierbei der Kalte Krieg als Motor gewirkt hat. Diese Auseinandersetzung war ja nicht nur eine Zeit militärischer und ideologischer, sondern zugleich auch wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Hochrüstung auf beiden Seiten. An dieser Spirale haben neue und alte Linke, eingeschlossen Arbeiterbewegung und Staatssozialismus kräftig mitgedreht, letzterer vor allem durch vielfältige soziale Sicherung und durch Kulturförderung. Allein aus der Eigenlogik der jeweiligen Systeme heraus wäre es innerhalb so kurzer Zeit vermutlich nicht zu einem solchen Entwicklungsschub gekommen. Doch hat diese Schraube die Leistungskraft beider Gesellschaftsformen übermäßig strapaziert. Im Osten kam das Ende abrupt, im Westen peu à peu. So gesehen ist nicht der Untergang der DDR erstaunlich, sondern die Tatsache, dass dieses tollkühne Unternehmen sich überhaupt so lange halten und im Kalten Krieg mitmischen konnte. Das entsprechende Selbstbewusstsein und der Stolz darauf fehlen den Ostdeutschen. 2. Anmerkungen zur Kapitalismuskritik Mehr oder weniger durchgängig beklagen die Autoren Globalisierung, Kommerzialisierung, Amerikanisierung, Ökonomismus usw. Auch das erscheint merkwürdig, weil das Kapital sich nur als Kapital verhält, wie schon im „Manifest“ nachzulesen ist. Wenn etwa Kritik an Einkommenskürzung und Sozialabbau geübt wird, dann müsste klargestellt werden, dass dies nicht zur Sicherung des Standorts Deutschland geschieht. Der ist insgesamt längst ausgereizt und abgeschrieben. Das Kapital muss dorthin ziehen, wo vergleichbare Arbeitskraft billiger zu haben ist. Die Proletarisierung großer Menschenmassen schreitet vor allem in Asien und in Osteuropa in rasantem Tempo voran. Wenn Linke Internationalisten sind, können sie das nur begrüßen. Denn die zivilisatorische Kraft des Kapitals wird langfristig erreichen, was staatssozialistische Produktionsverhältnisse, Handelsbeziehungen, Entwicklungshilfe und Solidaritätsaktionen nicht schafften – den Anschluss dieser Regionen an die „erste Welt“ und deren Errungenschaften. Sicher ist das eine einseitige, sträflich optimistische Sicht auf die Globalisierung. Dennoch haben linke Projekte hier anzusetzen. Aus der bloßen Abwehr heraus lassen sich vielleicht gewisse Sonderinteressen noch eine Weile verteidigen. Offensive Konzepte und Aktionen sind daraus jedoch nicht abzuleiten. Dem Erbe der Aufklärung, den Grundprinzipien der modernen Demokratie (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit) kann nur noch weltweit Geltung verschafft werden – oder gar nicht. Noch einmal zu den Beiträgen der Enquête: Man merkt, dass hier überwiegend ältere Herren am Werke waren, die ihre Karriere in der Blütezeit industriellen Wachstums, sozialer Sicherungssysteme und kultureller Infrastruktur gemacht haben. Schon allein die Existenz und komfortable Ausstattung ihrer Positionen als Kulturpolitiker, Kulturarbeiter oder Kulturwissenschaftler deutet darauf hin. Hinter den Reden vom Niedergang der Kultur im Zuge der Kommerzialisierung steht sicher auch die Angst vor der Proletarisierung des eignen Berufsstandes. Das Schicksal der einstigen Führungseliten des Ostens, die sich nun mehrheitlich in den Unterschichten wiederfinden, könnte auch Wortführern und Machern des westdeutschen Kulturbetriebes drohen. Ob man sich darüber noch groß Gedanken machen muss angesichts der Tatsache, dass die deutsche und europäische Bevölkerung im Weltmaßstab auf eine verschwindende Restgröße zusammenschnurren wird, sei dahingestellt. Die demographische Entwicklung wird in den Wortmeldungen kaum thematisiert, höchstens in Zusammenhang mit Kulturangeboten für Alte. Wer aber soll in 30 oder 50 Jahren die vielen Theater, Konzerthallen, Museen, Kultureinrichtungen aller Art füllen, um die heute so verbissen gestritten wird? Aus den gleichen demographischen Gründen wird der Einfluss der US-amerikanischen Kultur auf Europa zurückgehen. Wenn – wie für 2040 prognostiziert – der Durchschnittseuropäer doppelt so alt sein wird wie der Amerikaner, werden auf Jugend fixierte Angebote in Medien, Musik, Spiel, Sport, Mode usw. in Europa nicht mehr den nötigen Absatzmarkt bzw. Resonanzboden finden. Im Kino deutet sich das heute schon an. Wichtig wäre aber, ein Programm zu haben für die bereits begonnene Zeitspanne des Alterns und Schrumpfens der hiesigen Gesellschaft, Vorstellungen darüber, wie die Umverteilung zu Lasten der „besitzlosen Stände“ zu stoppen ist, damit auch diese ein angemessenes Leben führen können. Die DDR-Variante war sicher nicht berauschend. Sie hat jedoch den Vorzug, dass sie nicht nur ein Modell, sondern millionenfach gelebte Praxis war, an dem sich andere Konzepte werden messen lassen müssen. Kapitalismuskritik sollte nicht nachlassen. Aber sie muss sachgerecht ausfallen, nicht phantastisch. Hierzu sind neue theoretische Anstrengungen nötig. Die Beiträge der Enquête lassen erkennen, dass unter dem Druck allgemeiner Restauration hinter einst erreichte Positionen zurückgegangen wird. Was ist geblieben von einem weiten, kritischen Kulturbegriff, von einer gesellschaftlich eingreifenden Kulturwissenschaft? Will die Disziplin nicht zum Geleitschutz neoliberaler Politik verkommen, hat sie sich auf ihre emanzipatorischen Tugenden zu besinnen und ihr Handwerkszeug (Theorien, Methoden, Begriffe) auf den neuen Stand der Dinge zu bringen. Gerlinde Irmscher 
| |