| KULTURATION | Online Journal für Kultur, Wissenschaft und Politik Nr. 24 • 2021 • Jg. 44 [19] • ISSN 1610-8329 | Herausgeberin: Kulturinitiative 89 | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| Thema | Kulturation 1/2008 |
| Deutsche Kulturgeschichte nach 1945 / Zeitgeschichte | |
| Miriam Normann | |
| Kultur als politisches Werkzeug?
Das Zentralhaus für Laien- bzw. Volkskunst in Leipzig 1952-1962 | |
Text Miriam Normann als pdf Einleitung Die vorliegende Arbeit behandelt das Zentralhaus für Laienkunst der DDR in Leipzig, das sich später in Zentralhaus für Volkskunst umbenannte, in den Jahren 1952-1962. In der Arbeit wird oft auf den Begriff „Zentralhaus“ zurückgegriffen, da die Aussagen meist mehrere Perioden betreffen. In der DDR hat sich ein großer Teil der Arbeiter mit der Produktion von Kunst befasst. Der Anteil des Zentralhauses daran ist nicht zu unterschätzen, es hat die Laienkunst geleitet und entwickelt. Der Zusammenhang zwischen der Institution und der Umsetzung von Kultur im Volk soll in dieser Arbeit ergründet werden. In einem System, in dem der Staatsapparat eine so große Kontrolle ausübte wie in der DDR, sind die Aspekte Wirtschaft, Politik und Kunst nicht voneinander zu trennen. Die Arbeit des Zentralhauses hatte Einfluss auf das Alltagsleben vieler Bürger, die auf kultureller Ebene aktiv waren. Daher ist es interessant, die Art der Einflussnahme und die Auswirkungen des Zentralhauses zu untersuchen. Die Vorgaben, nach denen sich das Zentralhaus richtete, kamen von der SED und deren Vorstellungen zur Kulturpolitik. Wie identisch die Vorgaben der Partei und die Richtlinien des Zentralhauses sind, wird dabei näher betrachtet werden. Vor allem handelt es sich in der folgenden Untersuchung aber um die Institutionsgeschichte des Zentralhauses. Die Arbeit ist thematisch gegliedert und in den einzelnen Kapiteln wird chronologisch vorgegangen. In den verschiedenen Gebieten hat sich zu unterschiedlichen Jahren Besonderes ereignet. Davon abgesehen sind die Jahre nicht alle gleich gut in allen Arbeitsbereichen dokumentiert. Der direkte Vergleich ist also besser durch thematische Schwerpunkte zu ziehen. Der erste Teil der Arbeit stellt die politisch-kulturelle Situation dar, in der das Zentralhaus entstand und die Ursachen für dessen Gründung erläutert. Darauf folgend beginnt die eigentliche Auseinandersetzung mit dem Zentralhaus für Laienkunst. Es erscheint sinnvoll, zuerst die Strukturen des Zentralhauses offen zu legen. Dieses Kapitel behandelt die internen und externen Verknüpfungen der verschiedenen Einrichtungen und Abteilungen. Es werden die bestehenden Abteilungen und deren Zusammenarbeit mit anderen Institutionen in der kulturpolitischen Hierarchie der DDR vorgestellt. Hierbei stehen die Betrachtung der Abhängigkeit gegenüber den übergeordneten und der Einfluss des Zentralhauses auf die untergeordneten Hierarchien im Vordergrund. Der dritte Teil der Arbeit widmet sich den Aufgaben des Zentralhauses. Das Selbstverständnis des Zentralhauses als methodisch-anleitendes Institut muss dabei hinterfragt werden. Die administrative Arbeit, die Publikationen, die Veranstaltungen und die Arbeit mit anderen Ländern werden hierzu untersucht. Der vierte Teil thematisiert die erzieherischen Ansprüche und die Effektivität des Zentralhauses. Differenzen zwischen den Wünschen und Erfolgen in der Laienkunst kommen zur Sprache, sowie die Selbstdarstellung des Zentralhauses. Im letzten Teil wird der Einfluss des politisch-kulturellen Wandels Ende der Fünfziger Jahre beschrieben. Die Auswirkungen des „Bitterfelder Wegs“, die Fokussierung auf die Wirtschaft. Die folgende Arbeit konzentriert sich neben der Darstellung der Strukturen und Funktionen des Zentralhauses auf die Frage, ob das Zentralhaus seinen proklamierten Ansprüchen gerecht wird. Hierbei muss zwischen den Ansprüchen, die es nach außen hin vertrat und den tatsächlichen internen Zielsetzungen unterschieden werden. Das Zentralhaus vertrat den Anspruch, die Laienkünstler auf künstlerischem Niveau zu beraten. Es kann jedoch die These vertreten werden, dass das Zentralhaus sich weit mehr auf den ideologisch-erzieherischen Faktor, als auf den fachlich-künstlerischen konzentrierte. Als zentrales Thema wird das Spannungsfeld zwischen künstlerischer und ideologischer Anleitung im Zentralhaus untersucht. In diesem Zusammenhang wird der beratende Charakter in Frage zu stellen sein. Das Zentralhaus verfügte über diverse Mechanismen, die Volkskunst manipulierend zu beeinflussen. Die Formulierung „anleitend“ wirkt in diesem Zusammenhang euphemistisch. Auch intern genügte das Zentralhaus seinen eigenen Anforderungen nicht. Die Mitarbeiter waren mit den ungenauen Anweisungen überfordert und die Aufgabenbereiche nicht definiert. Es mangelte dem Zentralhaus an Struktur und Abgrenzungen. Diesem Umstand ist die mangelnde Effizienz und Durchsetzungskraft geschuldet. An dieser Stelle wird die These aufgeworfen, dass der „Bitterfelder Weg“ kein neues Konzept der Laienkunst entwickelte, sondern lediglich vom Zentralhaus schon entwickelte Ideen unterstützte. Neben aller Instrumentalisierung der Volkskunst zur Bindung an den Sozialismus soll jedoch auch untersucht werden, mit welchem Aufwand das Zentralhaus die Volkskunst in der DDR verbreitet. Man kann annehmen, dass Arbeiter und Bauern mit Kunst in Berührung kamen, denen diese sonst verschlossen geblieben wäre. Die kulturpolitische Situation vor der Gründung des Zentralhauses für Laienkunst Nach Ende des Zweiten Weltkrieges lag die Entscheidungsgewalt, ähnlich wie bei den durch die westlichen Alliierten kontrollierten Gebieten, in der sowjetisch besetzten Zone (SBZ) in der Hand der Besatzer. Der Einfluss der Sowjetunion auf die Kultur der DDR sollte auch in Zukunft nicht abreißen, sondern sich durch die folgenden Jahrzehnte ziehen. Von Anfang an wurde in den von der SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) herausgegebenen Richtlinien herausgestellt, dass mit dem neuen System nicht nur wirtschaftliche, sondern auch kulturelle Veränderungen einhergehen werden. Bereits am 17.7.1946 wurden kommunalpolitische Richtlinien entworfen, in denen die Werktätigen im Fokus der Kulturarbeit stehen. „[…] Bildung von Laienchor-, Theater- und Volkstanzgruppen. Organisierung von Kunst- und Kulturveranstaltungen zu Preisen, die für die Werktätigen tragbar sind.“[1]Schon hier wird erwähnt, dass der Werktätige sowohl als Konsument, als auch als Produzent der Kunst und Kultur in Erscheinung treten soll. Die Arbeiter sollten zukünftig stärker in das Kulturgeschehen des Landes eingebunden sein. Um dies zu gewährleisten, musste die Kunst nicht nur weniger elitär, sondern auch kostengünstiger angeboten werden. Schon zu einem frühen Zeitpunkt kann man die Vorgaben der SED erkennen. Die „Maßnahmen zur Durchführung der kulturellen Aufgaben im Rahmen des Zweijahresplans“ aus der Entschließung der 1. Parteikonferenz 1949 sollten für die nächsten Jahre und somit auch für die Arbeit des erst drei Jahre später gegründeten Zentralhauses für Laienkunst Maßstäbe setzen. Die Anforderungen an die Laienkunst finden sich nach dem Muster dieses Dokuments in unzähligen Anweisungen und Veröffentlichungen. Die anfänglich festgelegten zentralen kulturellen Aufgaben im Rahmen des Zweijahresplanes blieben die kulturpolitische Maxime, welche auch in den nächsten dreizehn Jahren propagiert wurde:„Durch die Festigung und Erweiterung der materiellen Grundlagen, auf denen sich das Leben der Bevölkerung in der sowjetischen Besatzungszone aufbaut, wird die Entwicklung aller kulturellen Einrichtungen gesichert und die Grundlage für eine Steigerung des Bildungs- und Kulturniveaus unseres Volkes, für das Aufblühen einer neuen humanistischen Kultur erweitert. […]Die zentralen kulturellen Aufgaben im Rahmen des Zweijahrplans sind:- Steigerung und Entwicklung des allgemeinen Bildungs- und Kulturniveaus unseres Volkes; - Entfaltung der künstlerischen Selbstbetätigung der Werktätigen. - Förderung und Entwicklung der Wissenschaft, Forschung und Kunst mit dem Volk und für das Volk. - Festigung der Bündnisse der Arbeiterklasse und Werktätigen mit der fortschrittlichen Intelligenz und die Entwicklung einer neuen demokratischen Intelligenz. Zur Erfüllung dieser kulturellen Aufgaben müssen alle Kräfte des Volkes ebenso mobilisiert werden wie zur Erfüllung der wirtschaftlichen Aufgaben des Zweijahresplans.“ [2] Hier sind bereits drei Punkte erkennbar, auf die sich die Vertreter der Volkskunst in der DDR immer wieder beriefen. Erstens soll das humanistische Erbe Deutschlands in der DDR erhalten und gefördert werden. Sich auf die klassisch-humanistischen Altmeister wie Goethe und Schiller zu berufen und sich als Verfechter ihrer Werke zu sehen, wurde als Wahrung der Tradition verstanden. Man wollte damit an die deutsche Kultur vor dem Faschismus anknüpfen. Zweitens wurde die Verantwortung zur Schaffung neuer Kunst vorrangig in die Hände der Werktätigen gelegt. Im Staat der Arbeiter und Bauern sollten jene auch den größten Teil der Kunst produzieren. Die Intellektuellen mussten ihre privilegierte Stellung als Kunstschaffende mit den Werktätigen teilen. Als dritter Punkt wird die Erfüllung von kulturellen und wirtschaftlichen Aufgaben als miteinander verknüpft bezeichnet. Diese Verknüpfung galt es zu stärken. In dieser Zeit ging es darum, die Wichtigkeit der Kultur zu betonen. Es wurden schon die Voraussetzungen für eine Verknüpfung mit der Wirtschaft geschaffen, die später noch intensiviert wurde. Die Mobilisierung der Arbeiter in der DDR auf künstlerischem Gebiet sollte stets eine zentrale Aufgabe des Zentralhauses für Laienkunst bleiben. Allerdings zeigte sich bald, dass diese Aufgabe nicht ohne Komplikationen zu erfüllen war. Zentralstelle für Volkskunst Die Zentralstelle für Volkskunst kann als Vorläufer des später gegründeten Zentralhauses verstanden werden. Das Aufgabenfeld der Zentralstelle war mit denen, die das Zentralhaus später zu erfüllen hatte, nahezu identisch. Vor allem war sie für die ideologische Betreuung der Volkskunstgruppen und Schulungen der Volkskunstfunktionäre zuständig. Die Zentralstelle galt als koordinierendes und anleitendes Organ, gab Informations- und Repertoirematerial heraus, organisierte Beratungen, Schulungen und Kunstveranstaltungen. Die Trägerorganisationen der Volkskunst sollten durch die Zentralstelle koordiniert werden. Demzufolge saßen die Vertreter von FDGB, FDJ, Kulturbund, DFD und Volksbühnen im Vorstand der Zentralstelle, die ihren Sitz in Berlin hatte. Das Ministerium für Volksbildung rief die Zentralstelle durch ein Verordnungsblatt ins Leben.[3] Ein Grund, warum die Zentralstelle für Volkskunst 1951 aufgelöst wurde, ergibt sich aus der Vereinigung zu vieler verschiedener Aufgabenbereiche in einer Person. Diese Verquickung erschwerte die Trennung der einzelnen Interessengebiete. Der Leiter der Zentralstelle, der eine unabhängige Instanz darstellen sollte, war auch Repräsentant der Volksbühne. Insofern unterstand die Zentralstelle letztendlich den Interessen der Volksbühne, die ursprünglich nur ein Teilbereich unter vielen sein sollte. Praktisch war die Zentralstelle der Volksbühne angeschlossen, wobei die Zentralstelle zeitgleich das Organ aller Massenorganisationen war. Diese Überschneidung ließ sich so nicht dauerhaft fortführen. Es entwickelten sich zwischen anderen Massenorganisationen, insbesondere der FDJ und der Zentralstelle Kompetenzstreitereien, da diese sich schlecht vertreten sahen. Es spitzte sich ein Duell zwischen Werner Thalheim (Leiter der Zentralstelle) und Sonja Klinz (Leiterin der FDJ) zu. Thalheim verließ die Zentralstelle; Fritz Plötzsch wurde als Nachfolger eingesetzt. Der Umstand, dass dieser später auch im Zentralhaus eine leitende Position bekleidete, weist auf die Verwandtschaft der Institutionen hin. Die Leitung der Zentralstelle hatte er nur kurz inne, da sie, ebenso wie die Volksbühne, am 3. Juli 1951 aufgelöst wurde.[4] Auch die Unterlagen des Zentralhauses geben als Grund für die Auflösung der Zentralstelle vorrangig die Kombination von zu vielen Funktionen, wie in der Position des Werner Thalheim vereint, und die feindselige Polemik, die vor allem von der Leitung der FDJ gegen die Zentralstelle geführt wurde, an. Das sozialdemokratische Gedankengut, welches in der Leitung der Volksbühne vordergründig vorhanden und in der Zentralstelle somit ebenso vertreten war, wird die Schließung der Zentralstelle und der Volksbühne begünstigt haben. Diese Schließungen haben in die kulturpolitische Organisation ein Loch gerissen, das die Gründung einer Institution wie das Zentralhaus für Laienkunst erforderte. Jedoch war das Zentralhaus als wissenschaftlich-methodisches Institut geplant und löste die Frage der Organisierung der Volksgruppen nicht. Der Mangel an fehlender Koordination und Aufgabenverteilung wird immer wieder thematisiert werden, da dies eine Hauptursache für die Stagnation im Zentralhaus war. Man kann sich die Frage stellen, ob die vermeintliche Schließung der Zentralstelle nicht eine Übergabe der Institution in die Leitung des Staates unter neuem Namen war. Zumal aus den Unterlagen hervorgeht, dass der Zentralstelle das Fehlen ideologischer Führung vorgeworfen wurde, damit die gewünschte Entwicklung der Volkskunst hemme und aus diesen Gründen das Ministerium für Volksbildung die Aufgabe fortan übernehme.[5] Die Auflösung der Volksbühnen und der Anschluss der Volkskunstgruppen an die Betriebe hatten formalen Charakter und vereinfachten die Kontrolle. Die Betriebe wurden aufgefordert, Kulturräume einzurichten. So wurde die Breitenkultur der DDR an die Betriebe gebunden und verstaatlicht.[6] Ursachen für die Gründung des Zentralhauses für Laienkunst Wie schon erwähnt, wurde die Zentralstelle für Volkskunst Mitte des Jahres 1951 aufgelöst. Die Lücke, die die Zentralstelle hinterließ, war nicht ohne weiteres zu schließen. Es musste eine Nachfolgeinstitution geschaffen werden, die den Aufgabenbereich der Zentralstelle abdeckte, jedoch besser in das staatliche System eingebunden war. Außerdem demonstrierte die Bildung einer solchen Instanz die Bedeutsamkeit der Volkskunst. Die Bevölkerung sollte an ihre Aufgabe als Produzenten der Kunst erinnert und als solche auch mit Aufmerksamkeit bedacht werden. Darüber hinaus gaben aber auch ganz pragmatische Ursachen Anlass für die Gründung des Zentralhauses für Laienkunst. Die für die Laienkunst zur Verfügung stehenden Räume, besonders in den ländlichen Gegenden, waren mangelhaft. Das Zentralhaus sollte die Bedingungen für die Volkskunstgruppen verbessern. Der Benzinmangel verursachte Transport-, der Papiermangel Druckschwierigkeiten. Die Verbreitung von Material trotzdem so effizient wie möglich zu gewährleisten, sollte Aufgabe des Zentralhauses sein.[7] Außerdem galt es, die nicht betriebsgebundenen Gruppen durch das Zentralhaus zu betreuen und anzuleiten. In einer Vorlage vom 21.8.1952 wurden die Aufgaben des Zentralhauses für Laienkunst in aller Kürze schriftlich umrissen: „1.) Die Zusammenarbeit mit den Bezirksvertretern: Das Zentralhaus muss sie anleiten, die politische Linie vorgeben und sich um die Arbeit der Kreise kümmern. Es muss durch monatlich Berichte und Verbindung über deren Arbeit unterrichtet sein. Das Zentralhaus muss einen Arbeitsplan mit den Bezirksvertretern aufstellen.“[8] Das Zentralhaus sollte die verschiedenen Instanzen und Gruppen zusammenführen und die größtmögliche ideologische Gleichschaltung in der Volkskunst erreichen. Es sollte sich durch die Berichterstattung der Bezirksleiter einen Überblick über die Volkskunst verschaffen und diese dann ganzheitlich anleiten. Die Abkapselung von Künstlern sollte verhindert werden, alle Kunstschaffenden in eine Gemeinschaft eingegliedert werden. So waren die Organisation, die Anleitung und die Kontrolle besser auszuführen. Der FDGB sollte die Betreuung der ihm angegliederten Volkskunstgruppen übernehmen und im Sinne der vom Zentralhaus vorgegeben politischen Linie durchsetzen. Am 15.1.1952 wurde das Zentralhaus für Laienkunst eröffnet, um sich fortan diesen Aufgaben zu widmen. Struktur des Zentralhauses für Laien-/Volkskunst Um die Arbeit, die Stärken und die Schwächen des Zentralhauses besser untersuchen zu können, wird als Grundlage der Aufbau der Institution dargelegt. Hierbei wird nicht nur ein Einblick in die internen Strukturen des Zentralhauses gewährt, sondern auch das externe Netzwerk, welches das Hierarchiegefüge um das Zentralhaus herum bildete, betrachtet. Obwohl die Gliederung im Zentralhaus klar benannt ist, stellte sich heraus, dass die Abgrenzung im Arbeitsalltag weit weniger geklärt war und die Wirksamkeit der Einrichtung in vielerlei Hinsicht lähmte. Abteilungen und ihre Zuständigkeitsbereiche Das Zentralhaus für Kulturarbeit gliederte sich in verschiedene Abteilungen. Die erste Auflistung über den Aufbau des Instituts, die in Dokumenten des Archivs verzeichnet war, stammt aus dem Jahre 1955.[9] Ob schon zur Gründung die Verteilung der Abteilungen so aussah, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Vielmehr ist anzunehmen, dass sich die interne Struktur im Laufe der Zeit ergab und vorerst ihren undefinierten Charakter behielt. In dem Statut von 1955 werden die Abteilungen mit ihren Zuständigkeitsbereichen aufgezeigt und definiert. Diese Aufstellung hat jedoch nicht den Anspruch vollständig zu sein, da sie nur vereinzelt aus dem Schriftverkehr ersichtlich geworden ist. Es ist davon auszugehen, dass es über die hier erwähnten Gebiete hinaus noch weitere Qualifikationen und Aufgaben gab, die nicht verzeichnet sind. Trotzdem erscheint es wichtig, diesen Einblick zu gewähren, um eine Vorstellung über die Abgrenzung der einzelnen Abteilungen voneinander darstellen zu können. Um Mitarbeiter des Zentralhauses für Laien-/Volkskunst zu sein, war es vor allem wichtig, eine linientreue sozialistische Haltung zu haben. Da sich diese Institution vorrangig als ideologisch-erzieherisch verstand, wurde auf dieses Kriterium besonderer Wert gelegt. Daraus darf man aber nicht schließen, dass alle Mitarbeiter nur die Ideologie vertreten sollten und Fachwissen über die Volkskunst dabei keine Rolle spielte. Gemeinsamkeiten der Abteilungen Auch wenn die Abteilungen sich durch ihre fachlich-thematischen Schwerpunkte unterschieden, so gab es doch strukturelle Gemeinsamkeiten. Jede Abteilung sollte ihrem Bereich entsprechend Publikationen herausgeben. Des Weiteren lag bei ihnen die Verantwortung für die operative Anleitung der Lehrgänge der Bezirkshäuser für Volkskunst. Ein weiterer Aufgabenbereich, den alle Abteilungen gemein hatten, war die Planung und Beschickung der Ausbildungsstätten für Laienkunst mit geeignetem Material. Die Vorbereitung der Fernkurse sowohl für anleitende Organe, wie beispielsweise Chorleiter und Regisseure, als auch die Kurse für die Volkskünstler zu organisieren, war ihre Aufgabe. Um die allgemeine Arbeitseffizienz zu verbessern, wurden regelmäßig Konferenzen einberufen. Das Leitungskollektiv beriet sich 14-tägig, die Arbeitsberatungen der Abteilungen fanden wöchentlich statt. Das Leitungskollektiv setzte sich aus den Leitern der einzelnen Abteilungen zusammen, an den Arbeitsberatungen der Abteilungen nahmen die Mitarbeiter derselben teil. Über die Sitzungen sind zahlreiche Protokolle vorhanden.[10] Unterschiede der Abteilungen 1. Abteilung Sekretariat: Über die Aufgaben dieser Abteilung konnten keine expliziten Angaben gefunden werden, man kann aber davon ausgehen, dass sie die üblichen Tätigkeiten eines Sekretariats erfüllte. 2. Abteilung Forschung: Die Abteilung Forschung war für die Sammlung von theoretischen Grundlagen verantwortlich und sollte dieses Material möglichst vielen Mitarbeitern im Land zugänglich machen. Darüber hinaus oblag ihr die Aufgabe, die Sammlungen und Forschungsarbeiten zu organisieren.[11] 3. Abteilung Chor, Ensemble, Musik: Diese Abteilung war für Veranstaltungen auf ihrem Fachgebiet verantwortlich, organisierte Chor- oder Musikgruppenwettbewerbe, Auftritte und Austauschreisen mit anderen Ländern, wie der BRD oder der Sowjetunion. Alle Gründungen und Auftritte, die dem Zentralhaus bekannt waren, wurden in den Akten festgehalten und zum Teil bewertet. Ab Januar 1956 erschien hier die Fachzeitschrift „Die Volksmusik, unser Wegweiser für Chöre und Instrumentalgruppen.“[12] 4. Abteilung Künstlerisches Wort: In dieser Abteilung wurde alles behandelt, was mit Theater oder schriftstellerischen Aktivitäten verbunden war. So bot sie beispielsweise Lehrgänge oder Fernkurse für Laienschauspieler oder Laienregisseure an. Ebenso betreute diese Abteilung die Zirkel[13] der schreibenden Arbeiter und hatte daher detaillierte Beschreibungen über die Zirkelarbeit und Zirkelmonographien vorzulegen.[14] 5. Abteilung Volkstanz: Hier sollte Volkstanzforschung gefördert werden. Ebenso war sie für die Erweiterung der Verbindungen mit westdeutschen und internationalen Gruppen verantwortlich. Durch Veranstaltungen, die sich mit Volkstanz beschäftigten, sowie Wettbewerbe oder Tanzabende, sollte sowohl die ideologische als auch die fachlich-künstlerische Kompetenz der Tänzer gefestigt werden. Das Repertoire für fortschrittliche Tänze und Arbeitsrichtlinien für Tanzgruppen wurde von dieser Stelle herausgegeben. Außerdem wurden Weiterbildungen für Tanzlehrer angeboten.[15] 6. Abteilung bildende und angewandte Kunst: Diese Abteilung organisierte die Produktion von Zeichnungen und Skulpturen. Sie versuchte aber vor allem die Herstellung von bildender Kunst zu fördern, die für die Gesellschaft anwendbar war, das heißt, einen praktischen Nutzen hatte. Daher standen Aktivitäten wie Reifendrehen, Klöppeln und Knüpfen im Vordergrund.[16] 7. Organisationsabteilung: Von den Aufgaben der Organisationsabteilung war zunächst kein klares Bild zu fassen. Es gibt aber den Vermerk, dass diese Abteilung den Abschlussbericht der 2. Deutschen Volksmusiktage 1957 verfasste[17]. Da dies thematisch auch zur Abteilung Chor, Ensemble, Musik gehören könnte, kann man davon ausgehen, dass die Abteilung Organisation einzelne Gebiete aus den Themen der anderen Bereiche übernahm. Außerdem war sie für überfachliche Veranstaltungen verantwortlich, wie die Herausgabe von Direktiven des Zentralhauses für Volkskunst über die Aus- und Weiterbildung der Volkskunstgruppenleiter im zweiten Fünfjahresplan[18]. Diese Abteilung ist besonders interessant, da bei der Gründung des Zentralhauses der methodisch-anleitende Charakter ausschlaggebend sein sollte. Die organisatorischen Aufgaben schienen dem Zentralhaus eher im Laufe der Zeit zuzufallen, da es dafür nach Auflösung der Zentralstelle keine Folgeinstitution gab. Die Verwirrung über die Aufgaben der Organisationsabteilung war auch im Zentralhaus selbst vorhanden. So äußerte sich „Kollege Keller“ 1956 in einer Diskussion darüber, dass ihm die Aufgaben dieser Abteilung nicht klar seien, da doch die Fachabteilungen an den Arbeitsergebnissen beteiligt seien und die Abteilung Künstlerisches Wort mit der Besetzung der Bezirkshäuser. „Kollege Nendel“ antwortete daraufhin, dass man davon ausgehe, dass das Haus eine Abteilung brauche, die sich um die Verbindung und die Verstärkung der Bezirkshäuser für Volkskunst und der Volkskunstkabinette kümmere.[19] Es kann also vermutet werden, dass sich die Organisationsabteilung für diese Aufgaben zuständig sah, somit aber mit anderen Abteilungen in Kompetenzstreitigkeiten geriet. Es scheint, als hätten die Fachabteilungen Teile der Organisation selbst übernommen. Der Verdacht liegt nahe, dass es die Organisationsabteilung nicht vom Jahre 1952 an gab. Dafür spricht auch, dass die Abteilung Organisation vor 1956 in den Dokumenten nicht erwähnt wird. Außerdem sollte es anfangs keine organisatorischen Aufgaben im Zentralhaus geben. Dies schien nicht mit der Realität konform gegangen zu sein und deshalb wurde die Abteilung Organisation gegründet, die sich in ihrem Kompetenzgebiet erst von den anderen Abteilungen abgrenzen musste. Eine Hauptaufgabe der Abteilung Organisation war also die Anleitung und Kontrolle der Bezirkshäuser. Hier ist ersichtlich, dass im Laufe der Zeit Vorhaben des Zentralhauses an die Realität angepasst werden mussten. Viele Ideen waren in der Theorie entworfen worden und mussten dann verändert werden. So auch die Annahme, dass das Zentralhaus nicht für die Organisation der Volkskunst verantwortlich sein sollte. Internes Verhältnis Durch die Schilderung der einzelnen Abteilungen ist die Grundstruktur des Zentralhauses dargelegt. In diesem Kapitel geht es nunmehr um die Vernetzung und den Informationsfluss zwischen diesen Abteilungen. „Die Abteilungen führen in ihren Fachgebieten auf der Grundlage des bestätigten Arbeitsplanes die künstlerisch-theoretischen und praktischen Aufgaben durch. Sie arbeiten eng mit den Mitarbeitern anderer künstlerischer Institutionen des Fachgebietes zusammen.“[20] Diese Vorgabe zur Arbeit der Abteilungen stammte von der SED. Die Partei hatte also direkten Einfluss auf die Arbeit des Zentralhauses. Diese Anordnung schien jedoch nicht so leicht umzusetzen zu sein. Bereits im Arbeitsbericht des ersten Quartals 1952 wurde auf die mangelhafte Zusammenarbeit der Sektionen untereinander aufmerksam gemacht. Dies ist zwar so kurz nach der Gründung nicht weiter verwunderlich, da sich jedes Institut erst in seinen Arbeitsablauf einfinden muss; dieses Problem wird aber in den folgenden Jahren immer wieder Erwähnung finden. In jedem Institut gibt es eine Rangfolge. Da die gesamte DDR von starken Hierarchien geprägt war, hatte eine staatliche Institution wie das Zentralhaus dementsprechend eine feste Hierarchie, die hier näher erläutert wird. Auch wenn Bezeichnungen wie „Kollege“ und „Diskussionen“ auf ein liberales Arbeitsklima deuten, war die Struktur innerhalb des Zentralhauses autoritär.Die Leitung des Zentralhauses für Laien- bzw. Volkskunst unterstand dem Direktor. „Der Direktor 1. leitet das Zentralhaus für Volkskunst, repräsentiert, nimmt dessen Interessen wahr. Verantwortlich für Durchführung der Gesetze. Er ist berechtigt alle Angelegenheiten des Zentralhauses für Volkskunst allein zu entscheiden 2. trägt gegenüber dem Ministerium für Kultur Verantwortung für Leitung. Er ist verpflichtet wichtige Entscheidungen mit jeweiligem Mitarbeiter zu fassen. 3. hat folgenden Aufgaben: a. Planung, Anleitung, Kontrolle und Koordinierung der künstlerisch-wissenschaftlichen Arbeiten der Abteilungen. b. Aufstellung des Arbeitsplanes, des Haushaltsplanes, des Stellenplanes sowie die ständige Kontrolle [H. d. A.] ihrer Erfüllung. c. Anleitung und Kontrolle [H. d. A.] der künstlerisch-wissenschaftliche Arbeit in den Bezirkshäusern für Volkskunst und den Volkskunstkabinetten. d. verantwortliche Entscheidungen in Kaderfragen. Die Sachbearbeitung für Kaderfragen untersteht dem Direktor unmittelbar. e. erteilt für grundsätzliche Publikationen des Zentralhauses für Volkskunst die Druckgenehmigung. 4. Der Direktor wird vom Ministerium für Kultur ernannt und abgerufen.“[21] Diese Festlegung der Kompetenzen und Verantwortungsbereiche des Leiters des Zentralhauses kann aufgrund der Tatsache, dass vom Zentralhaus für Volkskunst die Rede ist, nicht vor 1955 entstanden sein. Hier zeigt sich, wie schon bei der Festlegung der Aufgaben und der Abteilungen zu ersehen war, dass die konkrete schriftliche Fixierung über Strukturen oder Aufgabenbereiche nicht vor oder zeitgleich mit der Gründung stattfand, sondern im Laufe der Zeit entstand. Es scheint, die Gründung wurde ohne konkrete Konzepte vorgenommen und erst die Praxis schuf genauere Umstände, die später als Statut oder Direktiven festgehalten wurden. Der erste Direktor des Zentralhauses ab der Gründung 1952 war Werner Kühn. Ab dem Jahr 1957 folgte ihm Fritz Pötzsch. 1960-1963 wurde Rudolf Raupach (in den Unterlagen des Zentralhauses immer nur „Rudi“ genannt) Direktor des Zentralhauses. Die Angaben über die Funktion des Direktors weisen darauf hin, dass die Strukturen im Zentralhaus autoritär geschaffen waren. Ohne Einverständnis des Direktors durfte nichts das Zentralhaus verlassen. Er hatte in allen Entscheidungen das letzte Wort. So gibt es aus dem Jahre 1952 die Anweisung „keine Druckanweisung verlässt das Zentralhaus ohne Sichtvermerk des „Kollegen Kühn“[22] für die Zeitschrift „Volkskunst“. Daraus kann entnommen werden, dass die Vorgaben des Statuts in der Praxis umgesetzt wurden. Die Anrede „Kollege Kühn“ lässt nicht auf ein gleichgestelltes Verhältnis schließen, sondern offenbart die politische Gesinnung. Ebenso könnte dort anstatt „Kollege“ „Genosse“ stehen. Diese beiden Anreden waren die gängigsten in den Dokumenten des Zentralhauses. Aus diesem Grund sind über einige Mitarbeiter die Vornamen nicht in Erfahrung zu bringen und sie können im Folgenden nur mit dieser Anrede und ihrem Nachnamen Erwähnung finden. Die Autorität, die die Position des Direktors mit sich brachte, war mit großer Verantwortung verbunden. Letztendlich musste der Direktor für jeden Fehler, der vom Zentralhaus gemacht wurde, die Verantwortung tragen. Ob er dafür die fachliche Kompetenz auf allen thematischen Gebieten der Volkskunst hatte oder überhaupt haben konnte, muss an dieser Stelle unbeantwortet bleiben. „Kollege Keller“ hatte sich in einer Diskussion darüber beschwert, dass die „Organisationsabteilung das Instrument der Leitung sei, obwohl das alle Fachabteilungen sein müssten.“[23] Die Organisationsabteilung wird als delegierende Instanz beschrieben. Die anderen Abteilungen wurden gleichrangig empfunden. Es scheint also auch zwischen den Abteilungen ein hierarchisches Gefüge gegeben zu haben; zumindest wurde es von den Mitarbeitern so wahrgenommen. Das Zentralhaus in Zusammenarbeit mit Massenorganisationen Eine wichtige Aufgabe des Zentralhauses war die Zusammenarbeit mit den Massenorganisationen der DDR. Zu den Massenorganisationen in der DDR gehörten der FDGB, gegründet 1945[24], die FDJ, gegründet 1946, der VdgB, der DFD und die DSF. Nach der Auflösung aller Verbände und Organisationen der NS-Zeit sollten die neu gebildeten Massenorganisationen in der DDR einen überparteilichen Charakter haben. Die wichtigsten Massenorganisationen hatten festgelegte Mandate im Parlament und waren somit in die Volksvertretung integriert. Jedoch waren die Vorsitzenden der meisten Massenorganisationen gleichfalls Mitglieder der SED. Diese Übereinstimmung verstärkte den Einfluss der SED und brachte den Massenorganisationen die Funktion der Transmission ein. Sie sollten der Bevölkerung die politischen Ziele der SED nahe bringen. Allerdings wurden in den Massenorganisationen auch soziale Bedürfnisse und Konflikte besprochen. Mithilfe solcher Diskussionen konnte die SED Informationen gewinnen.[25] Die Massenorganisationen waren indes auch als Interessenvertretung gedacht. Sie sollten jeweilige Bevölkerungsgruppen wie Jugend, Bauern oder Arbeiter an sich binden. Diese mussten im Beitritt einen Vorteil für sich sehen. Die Massenorganisationen sollten die Bevölkerung möglichst flächendeckend erfassen und zugleich in soziale Gruppierungen, Altersgruppen, Berufsgruppen und Interessengemeinschaften gliedern. Die Massenorganisationen vertraten die Interessen der Gruppenmitglieder gegenüber der Partei. Dadurch sollten sich die Mitglieder zum Zweck der Systemstabilisierung ernst genommen fühlen. Allerdings unterdrückten die Massenorganisationen Kritik mitunter aber auch im Kern. Neben diesen politischen Aufgaben im Auftrag des Staates gewährleisteten sie die Kontrolle der Freizeitgestaltung ihrer Mitglieder.[26] Die Massenorganisationen sollten mit dem Zentralhaus zusammenarbeiten. Das Zentralhaus nahm dabei eine anleitende Funktion ein. Es ist nirgends explizit formuliert, dass die Weisungen des Zentralhauses bindend waren, sie werden als beratend beschrieben. „Die Abteilungen […] berufen Konferenzen und Besprechungen zum Erfahrungsaustausch ein. Hierbei arbeiten sie mit den Mitarbeitern der Bezirkshäuser für Volkskunst, den Volkskunstkabinetten, erfahrenen Gruppenleitern und Künstlern zusammen und beraten sie bei ihrer praktischen Arbeit.“[27] Der direkte Briefwechsel oder Bewertungen über Veranstaltungen erwecken allerdings nicht den Eindruck, dass die anleitenden Vorschläge viel Raum für alternatives Handeln ließen. Oft wurden genaue Daten für die Erfüllung der Verbesserungsvorschläge angefügt. Ideologische Kritik wird harsch geäußert und Veränderung gefordert. Die Massenorganisationen standen dem Zentralhaus gegenüber in einem „Rechtfertigungszwang“, waren aber nicht verpflichtet, Anweisungen Folge zu leisten. Es war allerdings nicht ratsam, mit einer staatlichen Institution, die direkt dem Ministerium für Kultur unterstand, im ideologischen Konflikt zu stehen. Auch wenn keine Sanktionen bei Zuwiderhandlung angedroht waren, konnte ein gespanntes Verhältnis zum Zentralhaus zu Komplikationen führen. Obwohl es zwischen dem Zentralhaus und den Massenorganisationen eine hierarchische Struktur gab, verlief die Zusammenarbeit nicht konfliktfrei. Das Zentralhaus für Laienkunst beschwerte sich bereits 1952 bei der zweiten Berichterstattung an die Staatliche Kommission für Kunstangelegenheiten, dass der FDGB die getroffenen Vereinbarungen nicht erfülle. Des Weiteren beteilige sich der FDGB zu wenig an anfallenden Kosten für Veranstaltungen, woraus die Notlage entstünde, Eintrittsgelder nehmen zu müssen.[28] Solche Streitigkeiten direkt nach der Gründung, die umgehend an die vorgesetzte Stelle weitergeleitet wurden, weisen auf ein sehr angespanntes Verhältnis zwischen FDGB und Zentralhaus hin. Das Zentralhaus leitete die Massenorganisationen nicht bloß an und gab Weisungen; es kontrollierte sie auch und gab Informationen an die höheren Instanzen weiter. Daraus ist ersichtlich, dass das Zentralhaus keine uneingeschränkte Weisungsbefugnis über die Massenorganisationen hatte. Die Notwendigkeit, mangelnde finanzielle Beiträge zu melden, lässt darauf schließen, dass das Zentralhaus solche beim FDGB nicht selbst einfordern und bei Missachtung sanktionieren konnte. So kamen auch die offiziellen Vorgaben über die Arbeitsweise einzelner Massenorganisationen nicht vom Zentralhaus, sondern direkt vom Zentralkomitee der SED. Das Zentralhaus führte hingegen Schulungen mit den Leitern der Massenorganisationen durch, um diese nach ihren Vorstellungen zu formen und sie zu unterweisen. Der folgende Abschnitt stammt aus solchem Schulungsmaterial des Zentralhauses für die Massenorganisationen: „Das Zentralkomitee macht die Genossen in allen Massenorganisationen auf die unzulässige Unterschätzung der ideologischen Arbeit aufmerksam, die in ihren Organisationen immer noch zu verzeichnen ist, und stellt ihnen folgende konkrete Aufgaben: a) In der FDJ ist die Schulungsarbeit als die Hauptaufgabe zu betrachten. Das erste Schuljahr wurde nur mangelhaft durchgeführt. […] Das ZK verpflichtet die Mitglieder der SED, unter der Jugend propagandistische Arbeit zu leisten, Lektionen und Referate zu halten. b) […] Das Hauptgewicht der gewerkschaftlichen Schulungsarbeit muss in den Betrieben liegen. Die Genossen in den Gewerkschaften müssen sich das Ziel setzen, im Laufe des Jahres 1952 mindestens 50% der Gewerkschaftsmitglieder durch die Betriebsschulung, durch organisiertes Vortragswesen usw. zu erfassen. c) […] Die Genossen in der VdgB müssen ihr Hauptaugenmerk gegenwärtig darauf richten, dass in den Wintermonaten in allen Dörfern Zirkel für die gesellschaftliche und fachliche Schulung der Bauern organisiert werden. Die VdgB muss sich mehr um die Entwicklung der Kulturarbeit in den Bauernstuben bekümmern und in den Wintermonaten Leseabende organisieren.“[29] Die inhaltlichen Forderungen sind vom Zentralkomitee (ZK) verfasst worden, es oblag aber dem Zentralhaus, sie an die Massenorganisationen weiterzutragen. Sich auf Weisungen des ZKs berufen zu können, verlieh dem Zentralhaus Autorität. Das Zentralhaus musste also keine Forderungen aussprechen. Solange es als Sprachrohr des ZK fungierte, waren Ratschläge bindend. Dennoch gab es in der weiteren Zusammenarbeit immer wieder Schwierigkeiten, insbesondere mit dem FDGB und der FDJ, den beiden größten und wichtigsten Massenorganisationen. Das Zentralhaus bemängelte oftmals die fehlende Anleitung für die Gruppen, die von diesen Organisationen betreut wurden. Es wurde der Vorwurf gemacht, dass sie ihre Bedeutung als Trägerorganisation unterschätzten, mangelnde Sichtwerbung betrieben und zu wenig im Vorfeld in den Betrieben über die Veranstaltungen diskutierten.[30] Dieses schwierige Verhältnis hat die Arbeit des Zentralhauses erschwert. Aufgrund der zahlreichen Veranstaltungen, die mit den Massenorganisationen ausgerichtet wurden, konnte man immer wieder Aufzeichnungen über Beschwerden oder Verbesserungsvorschläge finden. Die Zusammenarbeit mit dem FDJ und dem FDGB war eng und wurde daher immer wieder thematisiert. Noch 1960 äußerte sich Raupach, damaliger Leiter des Zentralhauses, dazu. Er appellierte an die Betroffenen, sich um mehr Engagement zu bemühen. Auch nach etlichen Jahren der gemeinsamen Arbeit war kein Einverständnis im Arbeitsprozess eingetreten. Raupach kritisierte in seiner Schlussrede wieder explizit und namentlich den FDGB und die FDJ: „In diesem Zusammenhang möchte ich eine Kritik an die beiden größten Massenorganisationen aussprechen (FDGB und FDJ) Es ist illusorisch ohne die Kraft dieser Organisationen der Bewegung Laientheater in planmäßiger Entwicklung Massencharakter zu verleihen.“[31] Die anderen Massenorganisationen bleiben eher im Hintergrund, was sicher mit ihrer geringeren Bedeutung in der öffentlichen Wahrnehmung zusammen hing. Dem VdgB wurde jedoch indirekt häufig vorgeworfen, die ländliche Bevölkerung nicht genug zu motivieren. Es ist allerdings fraglich, ob die schlechte Zusammenarbeit zwischen dem Zentralhaus und den Massenorganisationen tatsächlich durch Widerspenstigkeit der Organisationen hervorgerufen wurde, oder ob nicht vielmehr die ungenauen Vorstellungen des Zentralhauses die Umsetzung erschwerten. Das hätte eben solche mangelhaften Ergebnisse produziert, die das Zentralhaus an den Massenorganisationen kritisierte. Auch die Kritik an FDGB und FDJ in der Rede von Raupach ist nicht konkret und konstruktiv auf Handlungsweisen bezogen, sondern allgemein auf die Benennung von Mängeln reduziert. Die ungenügende Organisation und Motivation der Arbeiter, die das Zentralhaus kritisierte, lässt sich auch in Reflexionen über die eigene Arbeit immer wieder finden. Allein die Tatsache, dass zwischen den wichtigsten Vertretern der Volkskunst ein offensichtlich schlechtes Verhältnis herrschte, hat zu geringerer Effizienz in der Arbeit des Zentralhauses geführt. Die anleitende Funktion wird unter diesen Umständen nur schwerlich als willkommen angenommen worden sein, ist vielleicht sogar eher als Einmischung empfunden worden. Die Bezeichnung „Anleitung“ ist einer Befehlsgewalt nicht gleichzusetzen. Ein hierarchisches Gefälle zwischen dem Zentralhaus und den Massenorganisationen scheint zwar vorhanden gewesen zu sein, war aber nicht klar benannt. Solch ein Arbeitsverhältnis, welches unterschwellig hierarchisch ist, aber nicht offiziell als solches erklärt, musste das Arbeitsklima belasten und die Zusammenarbeit behindern. Kompetenzstreitigkeiten waren somit unausweichlich. Das Zentralhaus in der Hierarchie der Institutionen In der DDR herrschte eine zentralistische Struktur. Regionale Verwaltungseinrichtungen wurden nicht mit Verantwortung ausgestattet, sondern waren lediglich ausführendes Instrument der Anweisungen von oberster Instanz. Die Macht war im Zentralkomitee der SED gebündelt. Von dort kamen die Entscheidungen. Föderalistische Bestrebungen wurden nicht zugelassen.[32] Klare hierarchische Strukturen banden das Zentralhaus ein. Um diese Position zu verdeutlichen, soll hier die Stellung des Zentralhauses definiert werden. „Rechtsstellung und Name 1. Das Institut ist eine selbständige [H. d. A.] künstlerisch- wissenschaftliche Einrichtung. Es ist juristische Person und Rechtsträger des ihm übertragenen Volkseigentums, führt den Namen „Zentralhaus für Volkskunst“ und hat seinen Sitz in Leipzig. 2. Das Zentralhaus für Volkskunst ist dem Ministerium für Kultur unmittelbar unterstellt.“[33] Dieses Verhältnis ist ab 1954 deutlich definiert. Das Zentralhaus trug die Verantwortung für seine Handlungen, da es selbständig war, musste sich aber bei Fehlleistungen vor dem Kulturministerium rechtfertigen. Das Zentralhaus konnte Entscheidungen treffen, ohne das Ministerium um Zustimmung bitten zu müssen. Wenn das Ministerium aber Vorgaben machte, mussten diese vom Zentralhaus befolgt werden. Es handelt sich hier um eine eingeschränkte Entscheidungsgewalt. Durch einen Einblick in die Arbeitsweisen lässt sich viel über die Abhängigkeiten des Zentralhauses erfahren. Man kann im Statut ersehen, wem gegenüber das Zentralhaus in Rechtfertigungszwang stand, wem es Vorgaben machen konnte und wem es beratend und anleitend zur Seite stehen sollte. „Arbeitsweise 1. Das Zentralhaus für Volkskunst arbeitet nach Jahresplänen, die vom Ministerium für Kultur bestätigt werden. 2. Die Mitarbeiter des Zentralhauses für Volkskunst erhalten ihre Weisungen und Arbeitsaufträge durch den Direktor des Zentralhauses für Volkskunst und die Abteilungsleiter. 3. Die Mitarbeiter des Zentralhauses lösen ihre Aufgaben in enger Zusammenarbeit mit Künstlern und Wissenschaftlern und den erfahrensten Volkskunstschaffenden. […] Mit den Massenorganisationen, die Träger des künstl. Volksschaffens in den Betrieben und auf dem Lande sind, insbesondere dem FDGB, der FDJ, der VdgB und der DSF ist eng zusammenzuarbeiten. 4. Das Zentralhaus für Volkskunst arbeitet mit den Verlagen in der DDR, insbesondere mit dem VEB Hofmeister-Verlag zusammen, um ein vielseitiges und anspruchsvolles Repertoire-Material für die Volkskunstgruppen herauszugeben. Das Zentralhaus für Volkskunst hat durch Vereinbarungen mit den Verlagen die Herausgabe des Repertoire-Materials zu sichern und zu kontrollieren. 5. Der Vertrieb der erscheinenden Volkskunstmaterialien erfolgt durch den „Zentralvertrieb für Musikalien und Volkskunstmaterial, Leipzig (…), der dem Zentralhaus für kulturpolitische und künstlerische Fragen unterstellt ist. Das Zentralhaus für Volkskunst leitet den Zentralvertrieb an und koordiniert und kontrolliert ihn in diesen Fragen. 6. die künstlerisch-methodischen Zentren für das Volksschaffen in den Bezirken sind die „Bezirkshäuser für Volkskunst“ und in den Kreisen die „Volkskunstkabinette“. Sie sind damit Organe des Zentralhauses für Volkskunst und ihm in allen kulturpolitischen und künstlerischen Fragen unterstellt. Das Zentralhaus erteilt Weisungen, leitet an und kontrolliert [H. d. A.] die Bezirkshäuser und Volkskunstkabinette in den Kreisen. 7. Die Ausbildung leitender Kader für das Volkskunstschaffen führt das Zentralhaus für Volkskunst in seinen „Schulen für künstl. Volksschaffen“ Lehrgänge, Kurse und Konferenzen durch. Das Zentralhaus für Volkskunst erarbeitet verbindliche Lehrpläne, Studienmaterial und Dispositionen für die Aus- und Weiterbildung leitender Volkskunstkader durch die Bezirkshäuser und die Volkskunstkabinette. Das Zentralhaus für Volkskunst organisiert Fernkurse, besonders für die Leiter ländlicher Volkskunstgruppen. 8. Das Zentralhaus für Volkskunst nimmt Einfluss auf die Gestaltung der Ausbildungs- und Lehrpläne, insbesondere der künstlerischen Lehranstalten, die leitende Kader für das Volkskunstschaffen ausbilden. 9. Zur Durchführung seiner Aufgaben können die notwendigen Institutionen, wie Museen, Methodische Kabinette und Institute gebildet bzw. dem Zentralhaus für Kulturarbeit angeschlossen werden.“[34] Das Ministerium für Kultur bestätigte lediglich die Jahrespläne, es gab sie nicht vor. Das Zentralhaus hatte also das Recht, seine eigenen Ideen einzubringen, solange das Ministerium zustimmt. Besonders aufschlussreich bezüglich der Hierarchie ist der Punkt 6, in dem das Zentralhaus in einem Satz als anleitend und kontrollierend für die Volkskunstkabinette und Bezirkshäuser beschrieben wird. Da diese Einrichtungen letztlich vom Zentralhaus kontrolliert wurden, scheint es wenig Spielraum für Eigenverantwortlichkeit gegeben zu haben. Die „Anleitung“ scheint eine „Anweisung“ gewesen zu sein. Man kann nicht vollends ersehen, wie viel Einfluss das Zentralhaus in diesen Fällen wirklich hatte und wahrnahm. Es ist aber eben durch die explizit unterstellten Institutionen festzustellen, dass es dort einen Unterschied gab. Anleitung bedeutete für die unterstellten Institutionen nicht, von vornherein Entscheidungen treffen zu können, sondern das fertige Konzept erst im Nachhinein einsehen zu dürfen. Diese unklare Definition des Verhältnisses scheint zu einem großen Teil für die Konflikte zwischen Massenorganisationen und Zentralhaus verantwortlich gewesen zu sein. Obwohl es diese Auflistungen mit den Abgrenzungen gab, kam es in der Praxis häufig zu Versuchen, die Aufgabenfelder nochmals klar zu definieren und die Wichtigkeit der Abgrenzung zu betonen.In der Auswertung der 9.Tagung des ZK der SED im Jahre 1960 für das künstlerische Volksschaffen ist zu lesen: „[…] Die Aufgaben und Verantwortungsbereiche zwischen Staatsapparat (Ministerium für Kultur, Abteilung Kultur der Räte der Bezirke und Kreise) und nachgeordneten Einrichtungen und Institutionen müssen unter Berücksichtigung des vorwiegend methodischen Charakters des letzteren (Zentralhaus für Volkskunst, Bezirkshäuser, Volkskunstkabinette) konsequent abgegrenzt werden. […] Zwischen dem Staatsapparat, seinen Einrichtungen und den Massenorganisationen müssen die Aufgabenbereiche ebenfalls abgestimmt sein.“[35] Neben der offensichtlichen Problematik der Abgrenzung ist hier nochmals erwähnt, dass das Zentralhaus für Volkskunst sowie die Bezirkshäuser und Volkskunstkabinette vorwiegend methodischen Charakter haben sollten. In der Realität kamen aber dem Zentralhaus stetig massive organisatorische Tätigkeiten zu. Selbst wenn diese bei Gründung nicht geplant waren und darauf auch später noch beharrt wurde, blieb dieses Tätigkeitsfeld im Zentralhaus nicht aus. Hier deckte sich der geplante Aufgabenbereich nicht mit dem letztlich vollzogenen. Das Zitat gibt darüber Auskunft, dass die Verteilung der Aufgabenbereiche als unzureichend empfunden wurde. Solche Bemerkungen sind oft zu finden. Es wurde jedoch nicht der nötige Aufwand betrieben, um diesen Umstand zu beseitigen. Immer wieder wurde die schlechte Absprache und Abgrenzung im Netzwerk der laienkünstlerischen Institutionen benannt, jedoch schien niemand in der Verantwortung oder wies die Kompetenz auf, diese zu beheben. Im Anhang findet sich ein Organigramm, welches die Hierarchie der hier erwähnten kulturpolitischen Institute illustriert. Die Vorgesetzten Über dem Zentralhaus für Laien-/Volkskunst standen einige Instanzen. Auch wenn das Ministerium für Kultur ab 1954 die direkte übergeordnete Institution war, gab es auch andere staatliche Kontrollorgane, die dem Zentralhaus Vorgaben machen konnten, die Kontrolle ausübten und denen gegenüber das Zentralhaus seine Arbeit rechtfertigen musste. Im folgenden Abschnitt sollen diejenigen Organe vorgestellt werden, welche die Arbeit des Zentralhauses als Weisungsbefugte beeinflussten. Diese starken Hierarchien weisen darauf hin, dass die gesamte kulturpolitische Arbeit einem „großen Ganzen“ gewidmet war. Kunst wurde nicht zum Selbstzweck und somit eigenverantwortlich betrieben, sondern stand unter dem übergreifend erzieherischen Auftrag des politischen Systems und hatte sich deswegen auch vor allen Instanzen des Systems zu rechtfertigen und sich einzugliedern. Staatliche Kommission für Kunstangelegenheiten / Ministerium für Kultur Die Staatliche Kommission für Kunstangelegenheiten wurde im August 1951 gegründet. Kurz darauf entstand das Zentralhaus für Laienkunst und stand fortan zwei Jahre unter der Leitung der Staatlichen Kommission für Kunstangelegenheiten. Obwohl das Zentralhaus als eigene Institution gegründet wurde, nahm die Kommission Einfluss auf die Arbeit. 1952, also im Gründungsjahr des Zentralhauses, wurde der erste Wettbewerb der deutschen Volkskunst veranstaltet. Offizieller Veranstalter war das Zentralhaus für Laienkunst. Aus den Dokumenten geht jedoch hervor, dass die Vorschläge zur Durchführung der Kreisausscheide und die Teilnahme der Ensembles von den Landesorganisationsbüros an die Staatliche Kommission für Kunstangelegenheiten gingen und lediglich ein Durchschlag an das Zentralhaus.[36] Beide Institutionen wurden informiert, die Kommission hatte aber Vorrang. Ob deswegen die Staatliche Kommission mehr Entscheidungsgewalt die Ensembleauswahl betreffend hatte, kann aus der Quellenlage nicht geklärt werden. Möglicherweise handelte es sich nur um eine formelle Reihenfolge. In jedem Falle lässt die Bearbeitung der gleichen Unterlagen auf eine enge Zusammenarbeit schließen. Alle Aufgaben, die die Staatliche Kommission für Kunstangelegenheiten bezüglich des Zentralhauses innehatte, gingen am 7.1.1954 in das am gleichen Tag gegründete Ministerium für Kultur über. Das Ministerium für Kultur war nunmehr die direkt vorgesetzte Institution des Zentralhauses für Laien-/Volkskunst. Das Ministerium sollte das Zentralhaus beraten, kontrollieren und Weisungen ausgeben. Diese Befugnis nahm es durchaus wahr. Das Ministerium für Kultur gab alle zwei Jahre Schwerpunkte für die Kulturpolitik vor.[37] Diese waren die zu erfüllenden Normen für das Zentralhaus. Das Ministerium für Kultur und das Zentralhaus unterhielten regen Schriftverkehr, indem das Ministerium über die Arbeit informiert wurde und diese wiederum stark beeinflusste. Allerdings ist festzustellen, dass die Mitarbeiter des Zentralhauses auch Spielräume hatten, diese zu nutzen wussten und mitunter durch Diplomatie Einfluss auf die Entscheidungen des Ministeriums nehmen konnten. So konnte „Kollege Janietz“, Leiter der Abteilung Tanz, eine vom Ministerium angeordnete Überprüfung der Tanzlehrer der Volkstanzgruppen zu einer obligaten Weiterbildung aller Tanzlehrer umwandeln.[38] Daraus ist ersichtlich, dass die Einflussnahme durchaus möglich war und Anweisungen vom Ministerium nicht als in Stein gemeißelte Gesetze galten. Es gab einen Dialog zwischen den Institutionen, der zwar nicht gleichberechtigt war, bei dem aber durchaus beide Parteien sprechen konnten und gegebenenfalls auch gehört wurden. Das Zentralhaus unterbreitete dem Ministerium ebenfalls Vorschläge zur Verbesserung der Bedingungen auf dem Gebiet der Kulturarbeit. So machte das Zentralhaus in einem Brief vom 4.3.1954 an das Ministerium für Kultur den Vorschlag, mehr Lehrer für den Kunstunterricht auszubilden und mindestens zwei Kurzstunden Kunstunterricht in der Woche in Schulen einzuführen, damit bei der Jugend gar nicht erst fehlerhaftes künstlerisches Schaffen auftreten könne. Mit einer richtigen grundlegenden Ausbildung in der Schule durch richtige ideologische Qualifizierung sei falscher Gesinnung vorzubeugen.[39] Mit diesem Vorschlag wendete sich das Zentralhaus Fragen zu, die streng genommen außerhalb des eigenen Kompetenzgebiets lagen. Die Laienkunst bezog sich auf die Kunst in der Freizeit. Die Kunst in der Schule war nicht Teil ihres Aufgabenbereiches. Argumentiert wurde jedoch damit, dass die frühe Erziehung zur Kunst in der Schule die spätere Zuwendung zur Laienkunst förderte und somit ein solcher Schritt die Arbeit des Zentralhauses erleichtern und verbessern könnte. Der Brief, in dem sich das Zentralhaus zu Belangen des Ministeriums äußerte und ihnen Vorschläge unterbreitete, stützt die These, dass das Zentralhaus vom Ministerium als Gesprächspartner akzeptiert und ernst genommen wurde und sich das Verhältnis nicht nur auf autoritäre Beziehungen beschränkte. Die Untergeordneten In der Hierarchie, in der sich das Zentralhaus befand, war es nicht das letzte Glied in der Kette. Es gab etliche Institutionen, die ihm unterstanden und für die es verschiedene Funktionen erfüllte. Ebenso wie das Zentralhaus in das System eingegliedert war, trug es dafür Verantwortung, dass sich ihm unterstellte Institutionen ebenso einordneten, um der großen Idee des „neuen Menschen“ zu dienen. So wie es den erzieherischen Auftrag von oben bekam, musste es ihn nach unten weiterleiten, damit er letztlich bei der Bevölkerung ankam, wo dieser „neue Mensch“ entstehen sollte. Das Zentralhaus übte also Kontrolle aus, so wie es selber kontrolliert wurde. Nicht immer wurden diese Vorgaben nur autoritär weitervermittelt. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass sich eine untergeordnete Instanz tatsächlich gegen Vorgaben hätte auflehnen können, so wurden diese zumindest oftmals als Hilfestellungen formuliert. Bezirkshäuser und Volkskunstkabinette Die Bezirkshäuser sind als verlängerter Arm des Zentralhauses zu betrachten. Was das Zentralhaus für die DDR darstellte, sollte das Bezirkshaus jeweils für seinen zuständigen Bezirk leisten. Eine Aufgabe, bei der die Bezirkshäuser dem Zentralhaus administrative Arbeit abnahmen, war zum Beispiel die Vorbereitung der Weltfestspiele. Das Zentralhaus delegierte die Arbeit an die Bezirkshäuser: „1. Das Bezirkshaus beauftragt die Volkskunstkabinette seines Bezirks 2. Die Bezirkshäuser überprüfen die Einhaltung des Meldetermins 3. Die Bezirkshäuser unterstützen die Bezirksleitung der FDJ in der Auswahl der Gruppen und Solisten und die künstlerische Interessengemeinschaft bei der Organisation und helfen die besten Arbeiten auszuwählen, um dann die Übersicht an das Zentralhaus für Volkskunst zu schicken.“[40] Diese Informationskette ist für die Organisation der Weltfestspiele nachweisbar und legt die Vermutung nahe, dass die Arbeitsteilung bei anderen Veranstaltungen gleicher Größenordnung ähnlich verlief. Die Bezirkshäuser leisteten die Vorarbeit und sendeten die Ergebnisse dann zum Zentralhaus, um ihr Konzept dort genehmigen zu lassen. Die Bezirkshäuser arbeiteten für das Zentralhaus, hatten aber keine Eigenverantwortlichkeit oder Selbstbestimmung. Es gibt etliche Berichte von Besuchen von Mitarbeitern des Zentralhauses in den Bezirkshäusern verschiedener Gebiete, wie Cottbus oder Dresden.[41] Diese Berichte bewerteten die Arbeit, die dort geleistet wurde. Das Zentralhaus war für die Anleitung, aber auch für die Überwachung der Bezirkshäuser zuständig. Hier bestätigt sich erneut die These, dass Anleitung und Kontrolle in der Kulturpolitik der DDR untrennbar miteinander verbunden waren. Wie bei der Betrachtung der einzelnen Abteilungen schon kurz skizziert, war für die Bezirkshäuser die Abteilung Organisation zuständig. Sie sollte Sorge tragen, dass „die Bezirkshäuser hinsichtlich der Verwirklichung der kulturpolitischen Linie auf dem Gebiet der Volkskunst Veranstaltungen durchführen.“[42] Bei der Behandlung der Bezirkshäuser bleibt die Erwähnung der Volkskunstkabinette der Kreise nicht aus. Aus dem vorigen Abschnitt geht bereits hervor, dass die Bezirkshäuser den Volkskunstkabinetten ihres Bezirks Arbeit zuwiesen. Hier ging die Hierarchie weiter abwärts. Vom Zentralhaus über das jeweilige Bezirkshaus gingen die Anweisungen an die Volkskunstkabinette, die diese dann mit den bei ihnen gemeldeten Volkskunstgruppen durchsetzen sollten. Das Zentralhaus war also Vorgesetzter der Volkskunstkabinette, hatte aber die Bezirkshäuser noch in der Mittlerfunktion. Die Volkskunstkabinette arbeiteten dann direkt mit den Volkskunstgruppen zusammen. So ließ das Forum über Agitprop-Fragen am 14.12.58 in Berlin verlauten: „[…] Seit Juli verschicken wir, vom Zentralhaus abgezogen, Materialverzeichnisse heraus an die Bezirkshäuser und an Gruppen, die uns fragen. Von dort müssten sie über die Kabinette an euch gelangen.“[43] An dieser Stelle endete sowohl die Hierarchie als auch die Informationskette, beim untersten Glied, dem Laienkünstler selbst. Die Volkskunstkabinette hielten mitunter auch selbst mit dem Zentralhaus Kontakt. Es gab direkte Briefwechsel, gemeinsame Konferenzen und Feste. Probleme zwischen dem Zentralhaus und den Volkskunstkabinetten wurden ohne Zutun der Bezirkshäuser geklärt. Das Volkskunstkabinett hatte dem Zentralhaus für Volkskunst Stellungnahmen mit Problemen, Kritiken und Vorschlägen zu übersenden. Hier sind die Vorschläge eines Volkskunstkabinetts zur Verbesserung für die Zusammenarbeit mit dem Zentralhaus für Volkskunst: „Das Kabinett übersandte dem Zentralhaus für Volkskunst Arbeitspläne und Berichte, erhielt aber nie eine Stellungnahme. Es bittet das Zentralhaus in diesen Fällen zur Hilfe. Vereinbarte Tagungen sind überfällig, der Termin sollte zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch eingehalten werden.“[44] Aus dem Tonfall, den das Volkskunstkabinett dem Zentralhaus gegenüber anschlug, lassen sich einige Rückschlüsse ziehen. Die Vorschläge des Volkskunstkabinetts enthielten durchaus Kritik an der Arbeitsweise und der Zuverlässigkeit des Zentralhauses. Der Verweis auf die fehlende Stellungnahme zeigt dies deutlich. Allerdings war diese Kritik devot und geschickt platziert. Sie wurde mit der Bitte um Hilfe verbunden und signalisierte somit die Überlegenheit des Zentralhauses. Das Volkskunstkabinett wies zwar auf Mängel hin, gab aber vor, diese nur anzumerken, da es ohne die Hilfe des Zentralhauses nicht arbeitsfähig wäre. Diese Aussage muss den Mitarbeitern des Zentralhauses geschmeichelt haben. Die Volkskunstkabinette arbeiteten aber auch über weite Strecken selbständig. Dem Zentralhaus für Volkskunst lagen die Arbeitspläne, Kurzberichte und Analysen vor. Diese wurden selbstständig vom Volkskunstkabinett erarbeitet, aber mit dem Zentralhaus abgesprochen. Es ist zwar nirgendwo klar notiert, dass das Zentralhaus die Entscheidungsgewalt hatte, davon ist aber aufgrund der Struktur dieser Einrichtungen auszugehen. Es gibt keinen ersichtlichen Grund, warum die Bezirkshäuser letztendlich die Zustimmung des Zentralhauses brauchen sollten und die Volkskunstkabinette nicht. Nachdem die Bezirkshäuser und die Volkskunstkabinette in ihrer Funktion beschrieben wurden, stellt sich die Frage, ob diese Einrichtungen nicht eigentlich redundant waren, da sie ähnliche bis identische Aufgaben mit dem Zentralhaus verrichteten. Möglicherweise hätte eine Ausweitung der Arbeit des Zentralhauses diese zusätzlichen Institutionen ersetzen können und somit einen großen administrativen Apparat eingespart. Es stellt sich die Frage, ob die Bezirkshäuser und Volkskunstkabinette nicht nur Zweigstellen des Zentralhauses waren. Diese Überlegung wurde in der DDR im Zentralhaus 1955 auch angestellt. Es ließ sich ein Dokument finden, das wie folgt überschrieben war und die Frage nach der Notwendigkeit der Bezirkshäuser und Volkskunstkabinette thematisierte: „Vertrauliche Verschlusssache! Exposé über die Gründung eines Verbandes Deutscher Volkskunstschaffender (VDV) 1.9.55 Notwendige Veränderung: 1. Das Zentralhaus für Volkskunst und das Folklore-Institut geben die theoretisch-wissenschaftliche und künstlerisch-methodische Anleitung und die Grundlagen für Volkskunstmaterialien, die vom VDV zu massenpolitischer Wirkung mittels seines Apparates umgesetzt werden. Die Hauptrolle spielen dabei die Beratungs- und Vertriebsstellen in den Bezirken und Kreisen sowie ein Wochenblatt des VDV mit Fachteilen. Daher können die Bezirkshäuser für Volkskunst und die Volkskunstkabinette aufgelöst und ihre Aufgaben vom Verband übernommen werden. Das Zentralhaus für Volkskunst und das Institut erhalten damit rein künstlerisch-wissenschaftliche Aufgaben.“[45] Diese Umgestaltung ist so nicht umgesetzt worden. Weder wurden die Bezirkshäuser und Volkskunstkabinette aufgelöst, noch die Aufgaben des Zentralhauses beschnitten, vielmehr wurde ein weiterer Verband gegründet. Des Weiteren wurden die Aufgabenbereiche des Zentralhauses mit den Jahren klarer festgelegt und somit übersichtlicher, das heißt aber nicht, dass sie sich dadurch verringerten. Die Entscheidung, die Volkskunstkabinette zu erhalten, garantierte aber nicht deren reibungsloses Bestehen. So kann man über ihre Arbeit im Jahre 1957 erfahren, dass sie zwar noch existierten, sich aber in einer sehr schlechten Konstitution befanden. Die Anzahl der vorhandenen Kabinette war groß, die Effizienz jedoch gering. Diese Tatsache blieb auch den Mitarbeitern des Zentralhauses nicht verborgen. „Kollege Günther“ äußerte:„Die Masse der Volkskunstkabinette konnte mit den bisher üblichen Arbeitsmethoden keine Zusammenfassung der Volkskunstgruppen erreichen und solche umfassenden inhaltlichen Aufgaben lösen, wenn man überhaupt vom Vorhandensein von Kabinetten sprechen konnte, denn darunter muss man sowohl den entsprechenden Raum wie auch den Kreis der Mitarbeiter verstehen. Eine für die „Bearbeitung von Volkskunstangelegenheiten“ eingesetzte Person ist ja noch lange kein Kabinett.“ [46] Es ist wichtig festzustellen, dass hier die Ineffizienz der Bürokratie auf den Punkt gebracht ist. Der Anspruch, der an die Volkskunstkabinette gestellt wurde und die große Diskrepanz zur Realität, sind klar benannt. Die Ursache dafür scheint, wie erwähnt, am Personalmangel gelegen zu haben. Es hätten durch verbesserte Organisation und Verwaltung sicher auch einige Volkskunstkabinette zusammengeschlossen werden können, um ein Arbeitsteam zu bilden. Erneut wurde das Problem erkannt, jedoch nicht behoben. Kulturhäuser Die verstärkte Schaffung der Kulturhäuser wurde am 17. März 1952 beschlossen. Der Ministerrat ordnete mehr Kulturräume oder Kulturhäuser in den Gemeinden der DDR an. 1951 gab es bereits 565 Kulturhäuser in der DDR, ein Jahr später hatte sich die Anzahl verdoppelt.[47] Die Benennung dieser Einrichtungen, Kulturräume oder Kulturhäuser wurden synonym verwendet, verrät viel über die Funktion derselben. Sie sollten vor allem Raum bieten. In Kulturhäusern sollten sich Volkskunstgruppen treffen können, um zu proben und Veranstaltungen, Wettbewerbe, Lehrgänge und Feste stattfinden. Sie wurden als Gebäude für Kunstveranstaltungen verstanden. Als Treffpunkt für die Gemeinschaft sollten sie vor allem die Kirchen ersetzen.[48] Dieser Anordnung wurde jedoch nicht genügend Folge geleistet, denn es kam im Dezember 1953 nochmals zu einer konkreteren Verordnung: „[…]Unter anderem werden Maßnahmen zur grundlegenden Verbesserung der kulturellen Einrichtungen der Betriebe, der Literaturpropaganda, der Volks- und Laienkunstarbeit beschlossen. Bis zum 1. Mai 1954 sind sämtliche betriebliche Kulturstätten und Betriebsbibliotheken dem FDGB zur unentgeltlichen Nutzung zu übergeben. Der FDGB übernimmt 346 betriebliche Kulturhäuser und 10.946 betriebliche Kulturräume.“[49] Mit dieser Anordnung wurden die Kulturhäuser und Kulturräume dem FDGB unterstellt und damit unter staatliche Kontrolle gebracht. Das Angebot an Räumen, die sonst nicht zur Verfügung standen und die damit einhergehende Ballung von laienkünstlerischen Tätigkeiten, bot in diesen Häusern die Möglichkeit zur Beobachtung der Entwicklung der Volkskunst. Innerhalb dieser staatlichen Einrichtungen konnten die Betreiber jede Form von Subkultur verhindern. Diese Kontrolle wäre in der Privatsphäre der Laienkünstler nicht möglich gewesen. Die Institutionalisierung führte durch kulturelle Förderung und stetige fachliche Anleitung zur Hebung des Niveaus der Laienkunst.[50] So legitim der Vorwurf der Instrumentalisierung der Volkskunst gegen das Zentralhaus auch sein mag, die Verbreitung von Laienkunst in vorher undurchdrungene Gebiete gelang ihm. Das Zentralhaus übernahm anschließend die Qualifizierung der Klubleiter der gewerkschaftlichen Kulturhäuser. So wurden diese Einrichtungen, die vor allem Platz zum Gestalten bieten sollten, nach und nach mehr „auf Linie gebracht“ und von den Massenorganisationen und dem Zentralhaus geprägt. Durch die Ausbildung der Klubleiter wurden die Kulturhäuser zu einer der ausführenden Instanzen der Vorstellungen und Ideen des Zentralhauses. Da die Kulturhäuser aber keine methodisch-anleitende Funktion hatten, kann man sie nicht in die Gruppe der Häuser einreihen, die in direkter Linie mit dem Zentralhaus standen. Das Zentralhaus galt nicht als direkter Vorgesetzter der Kulturhäuser. Die Kulturhäuser wurden aus staatlichen Mitteln finanziert und verwalteten ihre Mittel selbst. Auch die Personalfragen entschieden die Kulturhäuser jeweils selbständig und ohne Rücksprache mit dem Zentralhaus.[51] Es gab zwar Anknüpfungspunkte, aber die Funktionen waren zu verschieden. Die Kulturhäuser waren keine Institutionen mit einem administrativen Apparat, der die Volkskunst organisieren sollte. Sie waren Orte der Praxis, die Ausführungsorte der administrativen Arbeit des Zentralhauses, der Bezirkshäuser oder der Volkskunstkabinette. Arbeitsgemeinschaften Die Arbeitsgemeinschaften sollten den Charakter der Selbstleitung der Volkskünstler stärken und damit auch deren Eigenverantwortung. Sie wurden im Jahr 1956 vom Zentralhaus ins Leben gerufen. Der folgende Abschnitt entstammt einer Schrift aus der Abteilung Organisation des Zentralhauses:„Über Bildung, Bedeutung und Aufgaben der Arbeitsgemeinschaften in der Volkskunst: Die deutsche Volkskunstbewegung hat in der Selbstverwaltung ihrer Belange und der Organisation von Veranstaltungen und Festen eine große Tradition. […] Die Arbeitsgemeinschaft ist eine gewählte (H. d. A.)Vertretung der Volksschaffenden einer bestimmten Fachsparte im Kreis bzw. Bezirk in der alle kulturpolitischen, künstlerischen und organisatorischen Probleme der betreffenden Volkskunstgruppen behandelt und gelöst werden. […] Die Entfaltung eines wahrhaft demokratischen Lebens in den Gruppen und Zirkeln selbst ist Voraussetzung für die allseitige weitere Demokratisierung in der Volkskunst. Neben der künstlerischen Arbeit ist die Pflege einer erzieherischen und in die gesellschaftlichen Aufgaben einmündenden Geselligkeit einzubeziehen. […] Die Arbeitsgemeinschaften haben ihren Sitz beim Volkskunstkabinett. […]Selbstverständlich ist bei der Bildung der Arbeitsgemeinschaften der Initiative von unten keine Grenze gesetzt. Aufgaben der Arbeitsgemeinschaften: Der Arbeitsgemeinschaft obliegt die künstlerisch-ideologische und organisatorische Leitung der Arbeit der Gruppen und Zirkel ihres Fachgebietes in ihrem regionalen Gebiet. […] Die Arbeitsgemeinschaft widmet sich insbesondere den Kräften, die nicht zu einer Gruppe oder einem Zirkel gehören, sich aber der Volkskunst betätigen wollen.“[52] Die Gründung der Arbeitsgemeinschaften war der Versuch, die Volkskünstler selbst mit in die Organisation und die Verwaltung einzubinden. Sie sollten in ihrem Umfeld Recherche betreiben und die Volkskünstler, die nicht in einem Betrieb oder einer staatlich erfassten Volkskunstgruppe organisiert waren, in solche Strukturen einbinden. Ein wichtiger Aspekt der Arbeitsgemeinschaften war ihr demokratischer Charakter. Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaften wurden gewählt und sollten dann die Interessen ihrer Sparten vertreten und sich mit der Lösung auftretender Probleme befassen. Dieses System erinnert an das Räteparlament. Die Volkskunstgruppen wählten Repräsentanten, die keiner Institution zugehörten, sondern zu ihnen gehörten. Damit wurde das Gefühl erzeugt, direkter auf die Verhältnisse in der Kulturpolitik Einfluss zu nehmen und somit die Demokratisierung des Systems mitzugestalten. Auf die Mitarbeiter des Zentralhauses hatten die Volkskünstler keinen Einfluss. Der Einfluss, den die Arbeitsgemeinschaften tatsächlich auf die Entwicklung der Volkskunst hatten, war allerdings nicht groß. Sie bekamen ihre Aufgabenstellung durch den Maßnahmenplan des Zentralhauses für Volkskunst.[53] Arbeitsgemeinschaften sollten Impulse in den Gruppen setzen: Repertoirefragen behandeln, die Kenntnisse des Spielmaterials verbreiten und besonders auch auf die fachliche Weiterentwicklung der Gruppen und Gruppenleiter Einfluss nehmen: Sie hatten also eine kulturpolitische Aufgabe zu erfüllen.[54] Insofern scheinen die Arbeitsgemeinschaften nicht das Konzept des Zentralhauses revolutioniert zu haben, sondern vielmehr die Pläne des Zentralhauses in die Volkskunstgruppen getragen zu haben. Dennoch konnten die Arbeitsgemeinschaften als Stimme ihrer Gruppe auftreten. Sie machten Vorschläge und schickten Hinweise ans Zentralhaus, die dort vermutlich auch Beachtung fanden. Zumindest wurden Briefe mitunter mit Kommentaren versehen, was voraussetzt, dass sie aufmerksam gelesen wurden. Der direkte Kontakt zum Zentralhaus wird nur sporadisch stattgefunden haben. Die Arbeitsgemeinschaften gehörten den Volkskunstkabinetten an und haben zumeist mit diesen zusammengearbeitet. Letztendlich hatten die Arbeitsgemeinschaften aber kein Stimmrecht, wenn es darum ging, Entscheidungen auf höherer Ebene zu treffen. Dies weist den demokratischen Grundgedanken in seine Grenzen. Demokratie würde bedeuten, dass die Arbeitsgemeinschaften nicht nur Ideen vorbrachten, sondern diese auch durchsetzten konnten, wenn sie dafür eine Mehrheit hatten. Gegen die Entscheidungen des Zentralhauses konnte aber nichts durchgesetzt werden. Die Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaften wurde vom Zentralhaus überwacht, und die Protokolle der Arbeitsgemeinschaften wurden an das Zentralhaus geschickt. Somit war das Zentralhaus stets über die Vorgänge und Veränderungen auf der untersten hierarchischen Ebene informiert.[55] Institut für Volkskunstforschung Das Institut für Volkskunstforschung wurde 1956 im Zentralhaus für Volkskunst gegründet. Leiter des Instituts wurde Dr. Paul Nedo, der vorher die Abteilung Forschung des Zentralhauses leitete. Das Ziel dieser Einrichtung sollten Forschung und Publikationen zur traditionellen Volkskunst sein.[56] Das Institut für Volkskunstforschung sollte also den Spagat schaffen, sich mit der Tradition zu befassen, ohne dabei rückständig oder gar reaktionär zu wirken. Die Berufung auf die Klassik wurde gerne zur Begründung angeführt. Schließlich könne nur die DDR der legitime Nachfolgestaat einer humanistischen Denkweise sein, wie sie Goethe und Schiller vertraten. Diese Tradition sei zeitlos und das Gedankengut stets aktuell und vorbildlich. Die Bundesrepublik wurde als imperialistischer Staat gesehen, der sich nie wahrhaft vom Faschismus gelöst hatte. Dieser Staat könne unmöglich in der Tradition der humanistischen Klassik stehen. Neben der Klassik, die in der DDR stets als Vorbild galt, war es wichtig die Arbeitertraditionen zu erforschen. Klaus Fiedler (Mitarbeiter des Instituts) erklärte die Arbeit des Instituts 1956: „Das Institut steht vor doppelter Aufgabe: Ziel der Arbeit, das reiche Erbe unserer Volkskultur wissenschaftlich zu durchforschen, zum anderen die überlieferten Schätze der Vergessenheit zu entreißen und sie für kulturelle Entwicklungen nutzbar zu machen.“[57] Sich in eine Tradition einzureihen vermittelt Sicherheit. Daher war eine wichtige Aufgabe des Instituts für Volkskunstforschung die Recherche von Kulturgut der Arbeiter aus der Weimarer Republik und auch aus der Zeit davor. Die Volkskunstgruppen sollten mit Materialien versorgt werden. Damit dieser Bedarf nicht gänzlich durch Auftragsarbeiten an Komponisten, Dramatiker und Schriftsteller gedeckt werden musste, sollte das Institut auf diesen Gebieten passendes Material aus der Vergangenheit finden, welches dann an die Volkskunstgruppen weitergeleitet werden konnte. Die Sammlung und die wissenschaftlichen Untersuchungen sollten der Erfassung zahlreicher Werke dienen. Dafür gab es detaillierte Arbeitsgebiete, die zu erforschen waren. Hier sollten vergessene Schriften, Lieder, Dramen und ähnliches ausfindig gemacht werden und eine Renaissance erleben. Das Zentralhaus litt in den Anfangsjahren unter Materialmangel. Die Arbeiter sollten mit vorbildlichen Theater- und Musikstücken, Chorsätzen und ähnlichem versorgt werden. Hier fand sich aber oftmals nicht genügend Auswahl. Aus diesem Grund wurde das Institut für Volkskunstforschung erschaffen. Es sollte diesen Engpass beseitigen. „Als Hauptaufgaben und Arbeitsprinzipien des Instituts galten: 1.künstlerisch-schöpferische Kräfte des werktätigen Volkes untersuchen, eingebettet in die historische Entwicklung 2. Konzentration auf Vorhaben, die für gegenwärtige und künftige kulturelle Entwicklung Bedeutung haben 3. engste und dauernde Zusammenarbeit mit Zentralhaus für Volkskunst herzustellen Hier ist eine Auswahl der Gebiete aufgelistet, die vom Institut für Volkskunstforschung zu untersuchen war: - die sprachliche Gestaltung der Volkskunst[…] - der Volkstanz, das Volksspiel und die Volksfeste - Erforschung der sprachlichen Überlieferungen im Volkskunstschaffen, Gebrauch von Mundart in Volksdichtung und Volksschauspiel […] - volkstümliche Elemente in Holz, Metall und Glasbearbeitungen, Töpferei und textilen Techniken - Güter und Schätze der Volkskultur vermitteln, welche durch den Kapitalismus vorenthalten worden waren - wichtige organisatorische und anleitende Funktionen zu erfüllen, wie die Koordinierung der Forschungsvorhaben auf volkskünstlerischem Gebiet, Anleitung von volkskünstlerischen Sammlungen und Forschungsarbeiten in Kreisen und Bezirken der Republik, internationale Zusammenarbeit pflegen, von anderen sozialistischen Ländern lernen, Ergebnisse Öffentlichkeit zugänglich machen“[58] Die Auflistung der Aufgaben in dem entsprechenden Dokument ist erheblich länger, führt mehr Punkte an und beschreibt die Aufgaben detaillierter. Die gewählten und gekürzten Beispiele sollen nur die Richtung der Aufgaben veranschaulichen. Das Konzept ist sehr vielseitig, doch die einzelnen Forschungsbereiche sind klar umrissen. Die Aufgabenstellung ist in kleine Teilbereiche gegliedert, die Fachwissen voraussetzen. Die Arbeit von Historikern wurde hier gefordert. Die Arbeitsbereiche sind präziser formuliert als die des Zentralhauses.Das Institut für Volkskunstforschung sollte den wissenschaftlichen Nährboden für die Arbeit des Zentralhauses bilden. Der Stellenplan für dieses Unterfangen sah für 1956 wie folgt aus: „2 Mitarbeiter für materielle Volkskultur 2 Mitarbeiter für sprachliche Gestaltung der Volkskultur 3 Mitarbeiter für Volkstanz-Volksspiel-Volksfest 2 Mitarbeiter für Volkslied und Volksmusik 1 Fotograph 1 Mitarbeiter für Publikationen 1 Mitarbeiter für fremdsprachliches Material und das Sekretariat“[59] Obgleich kein direkter Vergleich zur Personaldecke des Zentralhauses gezogen werden kann, da dort nicht so konkrete Zahlen vorliegen, kann festgestellt werden, dass das Institut für Volkskunstforschung mit wenigen Mitarbeitern ein immenses und konkretes Pensum zu erfüllen hatte. Es ist dem Zentralhaus in der Organisation und Konkretisierung der Arbeitsbereiche überlegen gewesen. An dieser Stelle kann erneut auf die mangelnden Koordinationsfähigkeit des Zentralhauses hingewiesen werden. Das später gegründete Institut für Volkskunstforschung ist dem Zentralhaus bereits einen Schritt voraus. Für die strukturierte Arbeit, die das Institut für Volkskunstforschung leistete, war nicht zuletzt Dr. Paul Nedo verantwortlich. Er ist wohl, als späterer Leiter der Domowina (Dachverband sorbischer Vereine) und Professor der Universität Leipzig, der bekannteste Mitarbeiter des Zentralhauses gewesen.[60] An seinen Ausführungen und Konzepten kann man die wissenschaftliche Grundlage seiner Arbeit erkennen. Ein Fazit, gezogen von Dr. Nedo, aus dem Jahr 1958, welches stichpunktartig verfasst wurde, liegt vor: „ -70 der wichtigsten Zeitschriften und Zeitungen durchgesehen, bibliographiert und gefundenes Material fotokopiert - Archiv soll ab März 1958 benutzbar sein - sprachliche Überlieferung: Reihe von theoretischen und kulturpolitischen Aufsätzen, Band demokratischen Bauernschwänke, Analyse der gegenwärtigen Mundartdichtung noch nicht gefördert wegen Krankheit Dr. Fiedlers - Volkslied und Volksmusik: Organisierung und redaktionelle Arbeit an einer Quellensammlung zum deutschen Volkslied, zehn Hefte - Volktanzforschung: völliges Neuland, Plan für Volkstanzarchiv, Erstellen von Bibliographie, - bildnerisches Volkslied: am wenigsten befriedigend durch Fehlbesetzung der Abteilung, Bildinventarisation in bescheidenem Umfang, einige Aufsätze und eine Broschüre“[61] Diese Analyse der geleisteten Arbeit ist prägnant und detailliert. Sie lässt die sonst üblichen vagen Formulierungen vermissen. An dieser Stelle wird wissenschaftliche Arbeit von Experten betrieben, die sich an Zahlen und Fakten orientieren. Dies soll nicht bedeuten, dass das Zentralhaus keine Leistungen erbrachte. Es ist aber auffällig, dass die Analysen vom Zentralhaus sehr viel ausschweifender und allgemeiner gefasst sind. Es gibt weniger konkrete Zahlen und mehr Ausführungen über Geisteshaltungen der Volkskünstler und Mitarbeiter. In der Analyse von Dr. Nedo wird „die Zusammenarbeit mit dem Zentralhaus von allen Beteiligten als unbefriedigend angesehen.“[62] Die verschiedenen Herangehensweisen und die unterschiedliche Art sich auszudrücken und Dinge zu formulieren, haben zu Kommunikationsschwierigkeiten geführt und die Arbeit behindert. Außerdem stoßen verschiedene Ansichten aufeinander. Dr. Nedo gehörte zu den wissenschaftlichen Facharbeitern. Er war Experte auf seinem Gebiet. Da es keine Berichte über seine mangelhafte ideologische Haltung gibt, war diese vermutlich auch vorbildlich. Sein Expertentum war aber in der Arbeit des Zentralhauses durchaus keine Selbstverständlichkeit. Viele Mitarbeiter waren vor allem auf die Vermittlung ideologischer Werte spezialisiert. Die Anleitung zu tatsächlicher Kunst spielte häufig eine untergeordnete Rolle. Diese Haltung ist bei Dr. Nedo nicht zu finden. Für ihn war die Verbreitung von Fähigkeiten auf dem Sektor Kunst eine zentrale Aufgabe. Er sah die Zustände in der Kulturlandschaft als problematisch an: „Spielt doch der Sektor Laienspiel weder in der Ausbildung der Theaterhochschule noch bei den Germanisten irgendeine Rolle. Es gibt in der DDR unseres Wissens nicht einen einzigen Fachmann für dieses Gebiet.“ [63] Dr. Nedo kritisierte den Mangel an Experten in der Arbeit des Zentralhauses. Er forderte Diskussionen für alle wissenschaftlichen Mitarbeiter, die verbindlich, nach festen Quartalsplänen durchgeführt werden. Darüber hinaus sollte es für die Zusammenarbeit mit dem Zentralhaus eine bessere Arbeitsteilung geben, die klar abgetrennt ist. Das Institut für Volkskunstforschung sollte keine pädagogischen und methodischen Aufgaben haben.[64]Diese Forderungen überraschen nach den hier getroffenen Einschätzungen Dr. Nedos nicht. Er machte konkrete Vorschläge in einem bereits festgelegten Zeitrahmen, strebte nach klareren Vorgaben und vor allem wollte er seine wissenschaftlichen Studien nicht mit pädagogischer Praxis vermengt sehen. Seine Arbeit war die fachliche Arbeit, für die er sich qualifiziert sah. Den erzieherischen Charakter der Volkskunst überließ er den Mitarbeitern des Zentralhauses. Obwohl das Institut für Volkskunstforschung im Zentralhaus gegründet wurde, grenzte es sich durch seine Art der Arbeit von diesem ab. Es war dem Zentralhaus untergeordnet, fand aber sein eigenes Profil. 1961 legte Nedo sein Amt als Leiter des Instituts nieder, da er an die Karl-Marx-Universität in Leipzig berufen wurde. Sein Nachfolger war Hans Marowetz. Seine Amtszeit wird hier nicht behandelt, da sie sich kaum mit dem untersuchten Zeitraum überschneidet. Die Tätigkeitsbereiche des Zentralhauses Nach der Erläuterung der Strukturen, die den Rahmen des Zentralhauses bildeten, folgt nun die Beschreibung seiner Aktivitäten. Der Aufgabenbereich des Zentralhauses war nicht von Beginn an klar umrissen. Die einzigen Arbeitsaufträge, die im Jahre 1952 schriftlich vorzufinden sind, betreffen die Schaffung von Kulturräumen und Kulturhäusern in den Gemeinden der DDR und die Zusammenarbeit mit den Bezirksvertretern. Ansonsten finden sich in den untersuchten Jahren immer wieder Aufgabenbereiche und Problemstellungen, für die das Zentralhaus offenbar verantwortlich war, ohne dass es in den ersten Jahren ein schriftliches Statut gab. Vielmehr müssen die Aufgabenfelder durch die Sichtung der Protokolle, Briefwechsel, Vorbereitungen und Bewertungen der Ereignisse rekonstruiert werden. Erst im Jahre 1958 gab es das erste offizielle Statut des Zentralhauses, welches seine Tätigkeitsbereiche und Ziele schriftlich fixierte und definierte. Da sich dies zum größten Teil mit den Aufgaben deckt, die auch schon in den Jahren davor ausgemacht werden konnten, ist das Statut hier zum Überblick angeführt. Es soll einen ersten Einblick in das Spektrum an Tätigkeiten geben. Die Aufgaben des Zentralhauses lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: „a. das künstlerische Volksschaffen auf der Grundlage der Kulturpolitik der Regierung der DDR in seinen vielfältigsten Erscheinungsformen und Genres unter den Kindern, Jugendlichen und Werktätigen zu entwickeln, so dass es als wichtigstes Mittel der Erziehung zum sozialistischen Bewusstsein aktiv zum Entstehen einer neuen sozialistischen Volkskunst beiträgt; b. die künstlerisch-schöpferischen Bedürfnisse der Werktätigen im Sinne der sozialistischen Bewusstseinsbildung anzuregen, sie aktiv in die sozialistische Volkskunstbewegung einzubeziehen und ihnen hierbei die Kenntnisse und Fähigkeiten zur Handhabung der künstlerischen Mittel zu geben; c. in den Arbeitsgemeinschaften der sozialistischen Volkskunstbewegung die Kräfte der Volkskunstschaffenden unter der Führung der Arbeiterklasse zu formieren und sie verantwortlich an der Lösung der staatspolitischen Aufgaben zu beteiligen; d. durch ständige, systematische Studien, vor allem in den Schwerpunkten des sozialistischen Aufbaues und auf dem Lande, die Rolle des künstlerischen Volksschaffens bei der Durchsetzung der Kulturrevolution zu analysieren und Maßnahmen zu treffen, die unter Ausnutzung aller agitatorisch-propagandistischen Möglichkeiten der Verallgemeinerung des Neuen dieser Entwicklung dienen. e. die allseitige Bildungs- und Erziehungsarbeit in den Gruppen entsprechend den Prinzipien der sozialistischen Moral und Ethik zu entwickeln, sowie in Verbindung mit den künstlerischen Lehranstalten der Republik, den Bezirkshäusern für Volkskunst und den Volkskunstkabinetten die Nachwuchsbildung auf dem Gebiet der Volkskunst, insbesondere die Aus- und Weiterbildung von jugendlichen Werktätigen aus den Betrieben und vom Lande zu fördern; f. die Repertoire- und Programmgestaltung der Volkskunst so zu bereichern, dass der Optimismus und die Kraft der Arbeiterklasse im Kampf um den Sieg des Sozialismus in höchster künstlerischer Qualität zum Ausdruck gebracht werden und damit der Erfüllung der politischen und ökonomischen Aufgaben dienen; g. durch wissenschaftliche Grundlagenforschung die progressiven Traditionen der deutschen Volkskunst, insbesondere die der Arbeiterkulturbewegung, freizulegen, das gegenwärtige Kulturschaffen des Volkes zu untersuchen und zu analysieren und die Ergebnisse für die lebendige Weiterentwicklung des gegenwärtigen Volkskunstschaffens nutzbar zu machen; h. im Sinne des proletarischen Internationalismus den Erfahrungsaustausch und die gegenseitige Hilfe mit den befreundeten und volksdemokratischen Ländern auf dem Gebiet der Volkskunst zu organisieren und Beziehungen mit fortschrittlichen Volkskunstschaffenden und Organisationen kapitalistischer Länder aufzunehmen und zu festigen; i. die antifaschistischen und demokratischen Positionen der Volkskunstschaffenden Westdeutschlands zu stärken und sie in ihrer künstlerischen Arbeit wie in ihrem politischen Kampf gegen den kulturfeindlichen westdeutschen Imperialismus zu unterstützen.“[65] Aus den Jahren davor existiert in den Unterlagen des Archivs der Akademie der Künste solch ein Dokument nicht. Dieser Umstand erklärt viele der immer wieder auftretenden Missverständnisse innerhalb des Zentralhauses. Die Aufgaben und Kompetenzen schienen oft nicht genau festgelegt und voneinander abgegrenzt zu sein. Schon in den Jahren zuvor wurden die anderen Punkte immer wieder als Aufgaben in verschiedenen Dokumenten erwähnt. Allerdings war die Erwähnung unsystematisch und nicht klar adressiert. Es scheint, als wären diese Punkte wünschenswerte Ziele gewesen, die Durchsetzung aber nicht geklärt worden. Ebenso werden in verschiedenen Bewertungen und Protokollen die Erfüllung der Aufgaben oder deren Scheitern behandelt. Man kann den Aufgabenbereich des Zentralhauses bis 1957 erahnen, sich aber auf keine offiziellen Unterlagen berufen. Das Zentralhaus hatte im Besonderen anfangs mit schweren konzeptionellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Wie schon erwähnt, ist davon auszugehen, dass viele der Probleme, mit denen das Zentralhaus in der Umsetzung seiner Konzepte zu kämpfen hatte, aus Schwächen in der Organisation und der Definitionen der Aufgaben resultierten. Die These, dass die unzureichende Zusammenarbeit im Zentralhaus zu dessen mangelnder Effizienz führte, wird bei der Betrachtung der Kommunikation innerhalb des Zentralhauses nochmals Beachtung finden. Im Folgenden werden nun die Aufgabenfelder ausführlicher erläutert, die sich voranging an Protokollen und Berichten belegen lassen. Kaderausbildung Das Zentralhaus organisierte Lehrgänge für die Volkskünstler in allen Fachgebieten. Bei diesen Lehrgängen kümmerte es sich um die Räumlichkeiten, war für die Auswahl der Teilnehmer verantwortlich und erstellte die Lehrpläne. Der Ausarbeitung der Lehrpläne galt besondere Aufmerksamkeit. Nicht selten lassen sich mehrere Entwürfe für einen Lehrplan finden. Wie bei allen Veranstaltungen, die das Zentralhaus ausrichtete, stand hier die erzieherische Prägung im Mittelpunkt. Es sollten zwar auch die fachlich-künstlerischen Kompetenzen geschult werden, aber die ideologische Festigung des Sozialismus war das primäre Ziel. So beschäftigte sich der Lehrplan zuerst ausgiebig mit der Frage der marxistisch-leninistischen Lehre von den Klassen und vom Klassenkampf. Die Teilnehmer sollten mit den Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung vertraut gemacht werden.[66] Nicht immer waren die Themen der Lehrgänge so praxisfern und dem Leben der Arbeiter enthoben. Es gab auch Lehrgänge, die die Grundkenntnisse zum Aufbau und zur Leitung eines Zirkels vermitteln sollten. Die Teilnehmer sollten befähigt werden, einfache Techniken weiterzuvermitteln sowie ideologisch-künstlerische Anleitung zu geben.[67] Wie deren Bezeichnung nahe legt, war die Weiterbildung für Teilnehmer gedacht, die schon eine Vorbildung hatten. Die Seminarpläne machen ersichtlich, dass bei Weiterbildungen oft der Erwerb von Qualifikationsnachweisen im Mittelpunkt stand. Das Zentralhaus für Volkskunst war berechtigt, Qualifikationsnachweise und Zeugnisse über die erfolgreiche Teilnahme an Weiterbildungen auszustellen. Diese Nachweise berechtigten die Inhaber zu leitender Tätigkeit in der Volkskunst entsprechend ihrer Qualifikation.[68] Das Zentralhaus entschied also über die Funktion und den Rang der Volkskünstler. Daraus lässt sich der Rückschluss ziehen, dass eine Volkskunstgruppe sich nicht einfach gründen konnte und ihren Leiter selbst wählte, sondern dieser vom Zentralhaus durch eine Weiterbildung zu diesem Posten qualifiziert werden musste. Durch diese Maßnahme hatte das Zentralhaus weiträumige Kontrolle über die Volkskunstgruppen. Die Kaderausbildung war ein vieldiskutiertes Thema im Zentralhaus. Man war dort mit der Ausbildung des eigenen Personals nie zufrieden. Es herrschte stets Einigkeit darüber, dass die Kader zahlreicher und auch besser ausgebildet werden müssen. Im Referat für die Konferenz am 3./4.3.1954 ist zu lesen: „Es kann vielen Gruppenleitern nicht schaden, wenn sie zur Erkenntnis gebracht werden, dass sie noch keine Meister sind und dass es auch ihnen nicht schadet, beharrlich und systematisch zu studieren. Diese umfassende Arbeit muss unter Anleitung des Zentralhauses für Laienkunst durch die Kabinette in den Kreisen erfolgen.“[69] Die vom Zentralhaus ausgebildeten Kader wurden dann meist zur Arbeit in die Volkskunstkabinette geschickt, um dort die Gruppen anzuleiten. Es wurde beständig nach Personal gesucht, das sich für die Arbeit auf dem Land ausbilden lassen und dann dorthin gehen solle. Die Kritik ließ über die Jahre nicht nach, sondern nahm eher zu: „Kaderanalyse auf dem Gebiet der Volkskunst 1955 Gesamt-Einschätzung: Die Mehrzahl der Gruppenleiter hat mit den erhöhten politischen und künstlerischen Aufgaben der Volkskunst nicht Schritt gehalten, besonders die ideologische Entwicklung der Volkskunstkader zeigt Zurückbleiben, die Rolle als Erziehungsfaktor ist noch relativ gering, Volkskunstgruppen reagieren auf politische Ereignisse nicht, entsprechen künstlerisch nur kleinbürgerlichen Kreisen. Die Entwicklung der Kader in den ländlichen Gebieten blieb sehr zurück, die Aktion „Industriearbeiter mit künstlerischen Fähigkeiten aufs Land“ brachte keine entscheidende Veränderung.“[70] Die Ansprüche an die Kader waren hoch, die Vorgaben gering. Der Vorwurf des mangelnden Erziehungsfaktors und der Kleinbürgerlichkeit ist universell einsetzbar und konnte bei jedem Missstand vorgebracht werden. Die Kader standen unter dem großen Druck, keine ideologischen Fehler machen zu dürfen, wobei es bei entsprechender Suche immer eine Möglichkeit gab, diesen Vorwurf anzubringen. Unabhängig davon auf welchem Gebiet das Verhalten eines Mitarbeiters zu kritisieren war, konnte es immer auf ideologische Schwächen zurückgeführt werden. Publikationen Die Veröffentlichung von Broschüren, Mitteilungsheften, Anleitungen und Zeitschriften war eine entscheidende Aufgabe des Zentralhauses. Die Publikationen sollten über die Arbeit der Volkskunst und des Zentralhauses informieren und zur Beteiligung aufrufen. Des Weiteren sollten sie ideologische und fachliche Fragen klären. Schon im Mai 1952 erschien die erste Ausgabe der „Volkskunst“. Diese Zeitschrift sollte das bedeutendste Sprachrohr des Zentralhauses werden. Es war die größte und wichtigste Zeitschrift zum Thema der Laien- und Volkskunst und überdauerte den hier untersuchten Zeitraum. Im Dezember 1953 ist eine Auflage von 8.980 Zeitschriften vermerkt.[71] Entsprechend der ihr beigemessenen Bedeutung war die „Volkskunst“ häufig Thema der Leitungssitzung und stand immer wieder im Mittelpunkt der Kritik. Die Veröffentlichungspraxis und die Aufgaben der Zeitschrift waren wie folgt festgelegt: „Die Zeitschrift 1. Das Zentralhaus für Volkskunst gibt die methodische Zeitschrift „Volkskunst“ heraus. Sie wird im VEB Hofmeister-Verlag verlegt und erscheint periodisch. 2. Die Aufgaben dieser Zeitschrift sind: a. Erläuterung der Probleme der Kulturpolitik b. Diskussion und Klärung der besten Methoden der künstlerischen Arbeit und Entwicklung der Talente der Werktätigen. c. Verallgemeinerung der Erfahrungen der besten Volkskunstgruppenleiter, Künstler und Wissenschaftler. d. Auswertung und Veröffentlichung der Erfahrungen des Volkskunstschaffens in anderen Ländern, insbesondere denen des Friedenslagers.“[72] Die Zeitschrift sollte alle Bereiche der Volkskunst abdecken - als Hilfestellung für alle Volkskünstler, die sich orientieren wollten. Im Januar 1956 erschien die Zeitschrift „Wort und Spiel“ als Fachausgabe der „Volkskunst“. Sie behandelte Probleme des literarischen Laienschaffens.[73] Die Anzahl der Fachausgaben stieg. „Volksmusik“, „Volkstanz“ und „Bildnerisches Volksschaffen“ kamen hinzu. Nach einiger Zeit wurde entschieden, dass es Fachzeitschriften geben sollte, die sich auf bestimmte Gebiete spezialisierten. Dieses neue Konzept der Zersplitterung wurde 1956 konkretisiert. Die Zeitschrift veränderte ihr Gesicht. Aus der 32-seitigen Monatsschrift wurden die vier genannten Fachausgaben mit je 24 Seiten, und eine monatliche Gesamtausgabe mit durchschnittlich 68 Seiten erschien: a: Wort und Spiel: für Dramatische Zirkel, Kabarett, Puppenspiel und künstlerisches Wort b: Volksmusik: für Chöre, Musikgruppen und gemischte Ensembles c: Der Volkstanz: für Choreographie, Tanzforschung, Körper- und Bewegungsschule d: Bildnerisches Volksschaffen: für Schnitzerei, Plastik, Malen und Zeichnen und alle Gebiete der textilen Volkskunst e: Gesamtausgabe der „Volkskunst“, die alle künstlerischen Fachsparten umfasst.[74] Die Fachabteilungen des Zentralhauses für Volkskunst übernahmen für die Fachteile jeweils die inhaltliche Verantwortung und mussten mit ihren Mitarbeitern satzfertige Manuskripte liefern. Bis 1956 bestand die Redaktion aus zwei Redakteuren. Die so genannte „Rumpfredaktion“ war für alle zentralen Seiten, Koordinierung, den technischen Ablauf und die Gesamtausgabe verantwortlich. Die nötige Umstrukturierung der Mitarbeiter ging zu Lasten der eigentlichen Aufgabenstellung der Abteilung, da keine zusätzlichen Arbeitskräfte eingestellt wurden. Es musste die volle Einsatzfähigkeit der Redaktion hergestellt werden, da die Publikationsarbeit unter dem personellen Mangel litt. Dies wäre nur mit der Erhöhung der Planstellen von drei auf sieben möglich gewesen. Um dies zu verhindern, sollte die Redaktion dem Zentralhaus für Volkskunst angegliedert werden. Unter diesen Umständen hätte die Arbeit der Zeitschrift bei Engpässen flexibler auf die dortigen Mitarbeiter verteilt werden können. Der stellvertretende Leiter des Hauses, „Kollege Heinze“, sollte dann die Verantwortung für die Redaktion tragen.[75] Im Jahre 1957 wurde der Antrag auf Überführung der Redaktion der Zeitschrift „Volkskunst“ samt ihrer Fachausgaben unter die Regie des Zentralhauses gestellt. Mit dem VEB Hofmeister-Verlag hatte es schon in den Jahren davor immer wieder Ärger gegeben, da das Zentralhaus die Arbeit des Verlags als unzuverlässig empfand. In Anbetracht dessen erschien die Beendigung der Zusammenarbeit als besonders attraktiv. Das Zentralhaus machte sich damit unabhängiger. Solche Unabhängigkeit führte aber in einem gewissen Grad auch zu zunehmender Eigenbrötelei und verhinderte zunehmend die Transparenz. 1957 lag die Auflage der „Volkskunst“ nach Angaben des Zentralhauses bei 11.500 bis 12.000 Exemplaren. Diese Zahl verlagerte sich mit der Zergliederung der einzelnen Fachzeitschriften auf 4.800 Exemplare der Gesamtausgabe, 1.200 „Volktanz“, 1.800 „Volksmusik“, 1.100 „Künstlerisches Wort“ und 850 „Bildnerisches Volksschaffen“.[76] An diesen Zahlen lässt sich ersehen, dass die Zersplitterung der Zeitschrift in die Fachausgaben die Auflage nicht steigerte, sondern sie im Gegenteil geringfügig senkte. In dieser Hinsicht war ein solcher Schritt nicht von Vorteil, denn die Steigerung der Auflage war stets ein angestrebtes Ziel, das viel diskutiert wurde. Im Juni 1957 gab es eine Sitzung zu dieser Problematik, in der sich Dr. Nedo äußerte:„Die Zeitschrift Volkskunst ist bei Gruppen bekannt, es wird jedoch behauptet, sie gäbe ihnen nichts. Von den früheren Vereins- und Verbandsblättern sind sie noch gewohnt, dass sie sich selbst darin wieder finden. Das ist eine Frage der ideologischen Umerziehung.“[77] Die Kritik der Leser wird zwar bis zum Zentralhaus vorgebracht, dort aber nicht angenommen. Diese Einschätzung von Dr. Nedo lädt zur sarkastischen Betrachtung ein: Wenn sich der Leser nicht mit dem Produkt identifizieren kann, dann muss sich eben die Identität des Lesers ändern. Es ist bezeichnend, dass an dieser Stelle an der Leserschaft gezweifelt wird und nicht an dem eigenen Erzeugnis. Die Redaktion erhielt den Auftrag, im Oktober 1957 vor dem Leitungskollektiv über eingeleitete Werbemaßnahmen und über eventuell verbesserte Arbeitsmethoden in der Redaktion zu berichten. Im Jahr 1960 erschien ab August noch zusätzlich die Fachzeitschrift „ich schreibe“ und ab 1961 das Infoblatt „Singt das Lied des Sozialismus“ im Zentralhaus für Volkskunst. 1961 wurde die Rentabilität der „Volkskunst“ bewertet und beschlossen, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, damit sich die Zeitschrift selbst finanziell tragen kann. Es wurde erkannt, dass die „Volkskunst“ dafür interessanter gestaltet werden musste. Die Zeitschrift musste für die Massen zugänglich und verständlich sein. Solche Probleme wurden auf den Leitungssitzungen des Zentralhauses thematisiert. Es folgt ein Auszug aus einem der Protokolle:„… dass die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Sektoren noch nicht beständig und hilfreich genug gestaltet ist. Viele Mitarbeiter der Fachsektoren im Zentralhaus für Volkskunst betrachten die „Volkskunst“ nicht als ihre Zeitschrift, für die sie mit verantwortlich sind.[…] Es wurde herausgearbeitet, dass die Fachausgaben nicht nur Zeitschriften der Leiter von Volkskunstgruppen sind, sondern für alle die Laienkünstler, die sich fest für eine künstlerische Betätigung auf einem Gebiet entschieden haben.“[78] Das Zentralhaus gab auch Broschüren, wie „Deutsche Festspiele der Volkskunst“, Mitteilungsblätter zu allerlei Themen und Arbeitshinweise für Jurys der Wettbewerbe heraus. Die wichtigste und umfangreichste Publikation blieb aber die „Volkskunst“ und mit ihren Fachausgaben. Öffentliche Veranstaltungen Die Werke, die die Volkskünstler produzierten, wurden in Ausstellungen gezeigt, die vom Zentralhaus ausgerichtet wurden. Das Zentralhaus legte die Thematik fest und wählte die Werke aus. Mitunter übernahmen auch die Volkskunstkabinette oder Bezirkshäuser eine erste Auswahl und sandten sie dann dem Zentralhaus zu, damit dieses die endgültige Entscheidung traf. Die Ausstellungen betrafen hauptsächlich die Abteilung Bildende Kunst. 1959 gab es eine Landwirtschaftsausstellung in Markkleeberg, bei der die Werke für den Verkauf bestimmt waren und die Materialkosten von den Volksschaffenden angegeben und dann ins Zentralhaus für Volkskunst geschickt werden sollten.[79] Wettbewerbe und Feste waren eine häufige Erscheinung in der Volkskunst der DDR. Es gab eine ausgeprägte und ritualisierte Festkultur. Das Zentralhaus veranstaltete regelmäßig diese Form der Darstellung von Künsten auf allen Gebieten. Wettbewerbsveranstaltungen verbanden verschiedene positive Aspekte für Volkskünstler und Zentralhaus. Die Teilnahme an einem Wettbewerb steigerte den Ehrgeiz der Gruppen. Die Konkurrenz unter den Gruppen veranlasste alle Teilnehmer, ihr Bestes zu geben. Der Vergleich und die Bewertung der Gruppen boten dem Zentralhaus die Möglichkeit, durch positive und negative Bewertung Einfluss auf die Arbeit der Volkskünstler zu nehmen. Die Werke, die die gewünschte Ideologie der Volkskunst in der DDR verkörperten, wurden ausgezeichnet. Wer bei solch einem Wettbewerb erfolgreich sein wollte, musste seine Arbeit diesbezüglich verbessern. An dieser Stelle konnte das Zentralhaus seinen Einfluss und seine Vorgaben geltend machen. Ein Aspekt, der bei Wettbewerben nicht unterschätzt werden sollte, ist die Unterhaltung. Ein Wettbewerb ist zumeist mit Spannung und Amüsement verbunden, was in der DDR der Fünfziger Jahre, in welcher Unterhaltung in der Kunst noch verpönt war, eine reizvolle Abwechslung dargestellt haben dürfte. Diese Wettbewerbe hatten zumeist einen festlichen Charakter, der Arbeitertraditionen und Bindungen an die sozialistische Gemeinschaft pflegte. Solche Veranstaltungen trugen zur Ritualisierung und Mythologisierung der gesellschaftlichen Praxis bei. Bei diesen Feierlichkeiten wurden staatsbezogene Riten etabliert und führten zu einem fließenden Übergang zwischen Fest und politischer Veranstaltung.[80] Administrative Arbeit In diesem Kapitel der Arbeit soll noch einmal verstärkt darauf hingewiesen werden, dass die Tätigkeit und die Dokumente des Zentralhauses kritisch hinterfragt werden müssen. Das Zentralhaus präsentiert sich selbst mit mannigfachen Aufgaben, die in den Unterlagen dokumentiert sind. Da dies alles Beschreibungen durch das Zentralhaus selbst oder andere staatliche Institutionen sind, muss man sie mit Distanz und Skepsis hinterfragen. Die Bezeichnungen, die das Zentralhaus für seine Tätigkeiten gewählt hat, scheinen mitunter nicht die tatsächliche Tätigkeit zu treffen. Oftmals ist die Arbeit facettenreicher und hintergründiger, als die formelle Betitelung vermuten lässt. Diese Betrachtung muss vor dem Hintergrund des totalitären Systems der DDR unternommen werden. Der Einwand ist an dieser Stelle wichtig, da administrative Aufgaben wie so genannte „Beratungen“ in ihrem Zweck hinterfragt werden müssen. In den Ausführungen des Zentralhauses wird immer wieder betont, dass seine Tätigkeit vor allem beratende Funktion hatte. Diese Bezeichnung beschönigt den Sachverhalt jedoch erheblich. Die Beratung glich zumeist einer Beeinflussung und Belehrung. So wurden oftmals Referate von Mitarbeitern auf Veranstaltungen, Tagungen oder Wettwerben gehalten, in denen die beste Arbeitsweise vorgestellt und angeraten wurde. Dies erweckte den Anschein, dass die Befolgung der Anleitung fakultativ wäre. Ganz so liberal war die Haltung jedoch nicht. Die Beratung wurde zwar als Hilfestellung formuliert, jedoch in der Erwartung, dass diese sodann als Maxime befolgt wird. Wenn die Arbeit einer Volksgruppe vom Zentralhaus als zu selbständig oder „abweichlerisch“ empfunden wurde, geriet die Gruppe in die Kritik und wurde zurück auf die vorgegebene Linie gebracht. Über Teilnahme an Veranstaltungen und Unterstützung entschied das Zentralhaus und hatte somit die Volkskunstgruppen unter Kontrolle. Wer nach Anerkennung strebte, musste sich nach den Vorgaben, beziehungsweise der Anleitung des Zentralhauses richten. Der Verwaltungsapparat nahm in der DDR einen immensen Raum ein. In einem System, das sich als sozialistisch versteht, wird ein dominanter Staatsapparat benötigt, der die Verhältnisse im Land regulierte. Nach Karl Marx und Wladimir Iljitsch Lenin ist der Staat das wichtigste Instrument zum Aufbau und zur Sicherung des Sozialismus. Es wurde versucht, den mächtigen Staatsapparat durch eine allgegenwärtige Verwaltung zu organisieren und somit die Kontrolle über die Bevölkerung zu erringen.[81] Das Zentralhaus als Teil der staatlichen Institutionen arbeitete auch nach diesem Muster.Wie an der Fülle von Unterlagen ersichtlich ist, oblag dem Zentralhaus die Verwaltung der Volkskunstgruppen und aller dazugehörigen Informationen. Im Archiv finden sich Unterlagen über unzählige Veranstaltungen, Planungen, Berichte, Bewertungen, Informationen über die Volkskunstgruppen und ihre Tätigkeiten, Teilnehmerbögen, Referate und Aufsätze über ideologische Fragen, Lieder, Texte, Brigadetagebücher, Briefwechsel und vieles mehr.[82] Es finden sich ordnerweise Meldebögen für Gruppen allerlei Bezirke, die an Wettbewerben (z.B. Deutsche Festspiele der Volkskunst ) teilnehmen wollten und diverse Informationen über die Gruppen, zum Beispiel: Gründung der Gruppe, absolvierte Auftritte, Probearbeit (Dauer und Anleitung), Repertoireangaben, Verbindungen zu Berufskünstlern, neue Werke, die in der Gruppe entstanden sind und welche Unterstützung die Gruppe erhält.[83] Diese Aufzählung kann ob der Menge des Materials nur fragmentarischen Charakter haben, doch sie bildet einen aussagekräftigen Querschnitt durch die am häufigsten vorkommenden Dokumente. Eine Aussage des Zentralhauses für Laienkunst über seine administrativen Aufgaben nach einjährigem Bestehen lautet wie folgt: „Neben inhaltlichen Aufgaben hatte das Zentralhaus auch administrative Aufgaben: So ist es verantwortlich für die Einleitung guter Zusammenarbeit mit demokratischen Behörden, Rundfunk und Presse, Vermittlung von Instrukteuren und Referenten, Errichtung von Archiven für Volkskunst, Erfassung von Laienspielern, Noten und Liederheften.“[84] Die Archivierung, die durch das Zentralhaus durchgeführt wurde, ist enorm. Ein Beispiel für den aufwendigen administrativen Apparat findet sich zum „Sozialistischen Volkskunstaufgebot“ 1958/1959. Zu dieser Veranstaltung finden sich zehn Ordner mit Berichten und Verpflichtungen der Volkskunstgruppen der einzelnen Bezirke.[85] Grundsätzlich ist es nicht außergewöhnlich, dass eine Institution über einen ausgeprägten Verwaltungsapparat verfügt und alle Unterlagen, die sich auf dort verrichtete Arbeit beziehen, archiviert. Das Bemerkenswerte an den im Zentralhaus archivierten Unterlagen ist vielmehr die Tatsache, dass es über auffällig viele Mitschriften und Kopien von Sitzungen und Gesprächen oder Veranstaltungen anderer Institutionen wie den Massenorganisationen, Volkskunstkabinetten und Bezirkshäusern verfügte. Dies weist erneut auf den weitgreifenden Kontrollmechanismus des Zentralhauses hin. Es sei nochmals betont, dass das Zentralhaus sollte bei seiner Gründung ein Institut mit methodisch-anleitender Funktion sein. Die Betrachtung der Aufgaben zeigte bereits, dass sich die Tätigkeit des Zentralhauses darauf nicht beschränkte. Es scheint, als wäre die Veranstaltungsorganisation dem Zentralhaus fast unmerklich zugefallen, da sonst niemand in der Verantwortung stand. Die Veranstaltungen brauchten nicht nur inhaltliche und fachliche Vorgaben, es musste sich auch um den Ablauf und die Umstände gekümmert werden. Da das Zentralhaus für die inhaltlichen Fragen zuständig war, wurden auch die organisatorischen Fragen an diese Stelle gerichtet. Schließlich gab es für derartige Fragen keinen expliziten Ansprechpartner. Das Zentralhaus als organisatorische Kraft wurde aus der Not geboren, da keine andere Institution für diese Fragen und Beschwerden zur Verfügung stand. Daher wurde das Zentralhaus in die Verantwortung genommen. Die zusätzliche Verantwortung des Zentralhauses führte dazu, dass es mehr Arbeit der Volkskunstgruppen forderte und erhielt dementsprechend auch die Antworten auf solche Forderungen, wenn diese für die Volksschaffenden nicht erfüllbar schienen. Vereinzelt gingen auch Briefe mit Beschwerden an das Zentralhaus: So schrieb im Januar 1962 die Tanzlehrerin Else Barsch, dass die Forderung nach verstärkter Nachwuchsausbildung Hohn sei, da sie nicht wisse, wie sie Unterricht durchführen solle, wenn sie keine Räumlichkeiten zur Verfügung hätte.[86] Auch wenn solche Kritik von Laienkünstlern oder Lehrern rar war, kann man doch entsprechende Briefe im Archiv finden. Es ist interessant zu sehen, dass die Klage über mangelnde Räumlichkeiten an das Zentralhaus gerichtet wurde, da dies ursprünglich nur methodisch und wissenschaftlich anleitend und nicht organisatorisch verantwortlich sein sollte. Das Zentralhaus wurde von den Volkskünstlern als verantwortliche Instanz für die Organisation angesehen. Es stellte sich diesen Aufgaben und versuchte, Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, um den Ablauf der Tanzveranstaltungen zu gewährleisten. Hier kann man erneut erkennen, dass sich der reale Aufgabenbereich nicht mit den anfänglichen Ideen deckte. Die Organisation wurde vom Volkskünstler als Aufgabe des Zentralhauses angesehen. Nachdem die neuen Aufgaben vom Zentralhaus erkannt wurden, sollten auf diesem Gebiet neue Leitlinien geschaffen werden. Sie sollten mit der Realität in Einklang gebracht werden, aber auch Gebiete der Organisation an andere Stellen delegieren. Über Schwierigkeiten in der Organisation wurden Besprechungen abgehalten und Statute angefertigt. Im Folgenden sind die Vorschläge zur Behebung der Probleme in der Kommunikation zusammengefasst, die die Abteilung Tanz für das Zentralhaus im Jahr 1962 erarbeitet hatte und der Leitung vorlegte: „- Es muss genau ausgearbeitet werden, wer überhaupt Aufträge an das Zentralhaus für Kulturarbeit geben kann. Es ist nicht möglich, dass alle Fachabteilungen des Ministeriums für Kultur Aufträge an die Sektoren des Zentralhauses für Kulturarbeit vergeben - Es muss genau geklärt werden, wieweit das Zentralhaus für Kulturarbeit mit dem Methodischen Kabinett des FDGB in Halle zusammenarbeiten muss, eventuell Zusammenlegung - Es gibt die Zeitschrift Volkskunst und Fachausgaben auf den künstlerischen Hauptgebieten sowie ein Organ der Klubarbeit heraus - Es muss festgelegt werden, um welche Wettbewerbe es sich dabei handelt, die das Zentralhaus für Kulturarbeit unterstützen muss […] Ein Hauptproblem der Diskussion war die Überbelastung des Zentralhauses mit organisatorischen Dingen. Bisher war es so, dass das Zentralhaus eine Konferenz, Tagung, usw. nach der anderen durchführte und sich dabei auch um organisatorische Fragen wie Unterkunft, Verpflegung usw. kümmern musste. Dieser Zustand führte dazu, dass die Auswertung der Konferenzen nur sehr mangelhaft vorgenommen werden konnte, weil bereits das nächste Fest vorbereitet werden musste und die Zeit für eine gründliche Auswertung fehlte.“[87] Auch zehn Jahre nach der Gründung sind die Kompetenzen des Zentralhauses noch nicht klar definiert. Hier ist der erneute Versuch zu finden, die Arbeitsbereiche festzulegen, Teile der Organisation zu übernehmen und andere abzuwenden. Das Zentralhaus selbst stellte sich die Frage, ob es ein Organisationsapparat oder ein methodisches Institut sei. Aus den neuen Vorschlägen geht hervor, dass die Organisation keine zentrale Rolle in der Arbeit des Zentralhauses spielen sollte, sich aber nicht gänzlich vermeiden ließ. Es ist bemerkenswert, dass im Zentralhaus die Schwäche in der Organisation und in der mangelnden Definition der Aufgaben früh erkannt wurde und dennoch innerhalb der ersten zehn Jahre keine Verbesserung oder Veränderung dieses Umstands zu erkennen ist. Die Doppelbelastung von Organisation und inhaltlicher Anleitung überforderte das Zentralhaus offenbar. Die Problematik wird zwar in den Besprechungen immer wieder aufgeworfen, es können jedoch keine eingeleiteten Maßnahmen festgestellt werden, die diesen Umstand beheben sollten. Vor allem hätte festgelegt werden müssen, wofür das Zentralhaus nicht verantwortlich ist und diese Grenze hätte mit Konsequenz vertreten werden müssen. Ob diese Abgrenzung im Verlauf der Sechziger Jahre besser gelang, wird in dieser Arbeit aufgrund des zeitlichen Rahmens nicht untersucht. Finanzierung Die Unterlagen, die sich mit den Finanzen und dem Unterhalt des Zentralhauses beschäftigen, sind im Vergleich zum Gesamtkorpus der Dokumente nur vereinzelt zu finden. Dies könnte daran liegen, dass der Haushaltsplan des Zentralhauses einen selbständigen Bestandteil des Haushaltsplans des Ministeriums für Kultur bildete und damit in dessen Zuständigkeitsbereich fiel.[88] Der Finanzrahmen wurde vom Ministerium entschieden und musste vom Zentralhaus eingehalten werden. Generelle Finanzierungsplanungen fanden also an dieser Stelle statt und wurden in den Sitzungen des Zentralhauses nicht behandelt. Im Zentralhaus wurde lediglich die Verteilung der Mittel diskutiert. Besonders in seinen Anfangsjahren wirkte der allgemeine Mangel der Nachkriegszeit lähmend auf alle Vorgänge. Fehlende finanzielle Mittel verhinderten die Durchführung von Maßnahmen. Dies wurde in Besprechungen der Leitungssitzungen als besonders problematisch beschrieben, da das Zentralhaus sich Wege überlegen musste, um den Betriebsausfall bei Laienkünstlern zu ersetzen.[89] Es war wichtig, die Laienkünstler nicht durch zusätzliche finanzielle Einbußen bei künstlerischer Betätigung abzuschrecken. So wurde versucht, geringe Aufwandsentschädigungen an die Volkskünstler auszuzahlen, die sich an Volkskunstveranstaltungen beteiligten und somit einen Arbeitsausfall erlitten. Mitte der Fünfziger Jahre konnten die Mittel für die Volkskunst erhöht werden. Während 1951 600.000 Mark für die Volkskunst zur Verfügung standen, wurden 1954 9.000.000 Mark in diesen Bereich investiert. An dieser immensen Steigerung lässt sich der besondere Stellenwert, den die Volkskunst in der DDR einnahm, erkennen. Hinzu kamen noch Kulturfonds, Gewerkschaftszuwendungen und Direktorenfonds.[90]Diese Ausgaben in der Volkskunst konnten jedoch nicht dauerhaft erhalten bleiben. 1957 ist bei der Leitungssitzung im Zentralhaus von Einsparungsmaßnahmen die Rede: „1. Ergebnis der Einsparungsmaßnahmen: Vorschläge zur Einsparung sind real und diskutabel, weitere Einsparung nicht durchführbar, da sonst Führungscharakter des Zentralhauses für Volkskunst nicht mehr gesichert und es die Arbeit um ein Jahr zurückwerfen würde. „Kollege Brattke“ beauftragt das Zentralhaus für Volkskunst unter Einsparungen einen neuen Stellenplan aufzustellen.“[91] Das Zentralhaus musste sich den Forderungen des Ministeriums fügen. Die Forderung nach einem neuen Stellenplan unter den gegebenen Einsparungen macht deutlich, dass die Mitarbeiter um ihre Arbeit bangen mussten. An dieser Stelle ist der Verweis angebracht, dass die ständige Bedrohung durch Einsparungen ein Grund für die permanente Betonung der Notwendigkeit des eigenen Fachgebiets sein dürfte. Die Angst vor Streichungen und Schließungen einzelner Abteilungen war allgegenwärtig. Nur wer sich für die Stärkung des Sozialismus als unentbehrlich ausweisen konnte, war des Erhalts seiner Stellung sicher. Die Volkskunst blieb von der wirtschaftlichen Situation der DDR nicht unberührt. Die Ausgaben mussten eingeschränkt und häufiger gerechtfertigt werden. 1962 stand es um die finanziellen Mittel des Zentralhauses so schlecht, dass die Diskussion im Ministerium für Kultur für den Haushaltsplan ergab, dass eine Kürzung der Honorare vorgenommen werden müsse.[92] Das Zentralhaus musste versuchen, die Beschlüsse in der Praxis umzusetzen. Es ist allerdings nicht davon auszugehen, dass die schwindenden Mittel in dieser Periode mit einer Geringschätzung der Volkskunst einhergingen. Die Einsparungen sind auf mangelnde Mittel generell zurückzuführen. Die Volkskunst hatte zu diesem Zeitpunkt keinen Imageverlust erlitten. Das Zentralhaus als Kommunikationsmedium Eine der wichtigsten Aufgaben des Zentralhauses war es, als Sprachrohr zwischen anderen Instituten zu fungieren. Wie beschrieben wurde, arbeitete das Zentralhaus mit vielen anderen Stellen in der DDR zusammen, die das Kulturleben gestalteten. Für diese Organisationen und Institute stellte das Zentralhaus ein Bindeglied dar. Es bemühte sich um einen Überblick über die Tätigkeiten der verschiedenen Stellen, um zu koordinieren und wichtige Informationen weiterzuleiten. Besonders an die unterstellten Organisationen und Häuser, wie die Volkskunstkabinette und Bezirkshäuser, verteilte es Mitteilungshefte und Materialien für die dortige Arbeit.[93] Auch für die Kooperation der verschiedenen Häuser und Organisationen, insbesondere bei der Vorbereitung von gemeinsamen Veranstaltungen war das Zentralhaus verantwortlich. Das Zentralhaus veranstaltete Treffen der Leiter der Volkskunstkabinette und Bezirkshäuser. Ebenso bekam es die Aufgabe vom Ministerium für Kultur, die Mitarbeiter der Bezirkshäuser und Volkskunstkabinette über anstehende Tagungen zu informieren.[94] Das Zentralhaus richtete also nicht nur selbst Veranstaltungen aus, um Mitarbeiter aus verschiedenen Ressorts zusammenzuführen, es fungierte auch als Bote und Bindeglied zwischen dem Ministerium und den untergeordneten Kulturhäusern. Oftmals delegierte das Zentralhaus Aufgaben, die es selbst auf überregionalem Gebiet zu erledigen hatte, an Häuser weiter, die diese Aufgaben dann in ihrem Einzugsbereich erledigten. Die Kommunikation mit der Presse war ebenfalls Teil der Informationsverbreitung. Letztendlich war das Zentralhaus für die Weiterleitung von Informationen zuständig. Die Direktive über die Durchführung der „Woche der Volkskunst“ in den Bezirken und Kreisen der DDR 1959 lautete: „[…] Das Zentralhaus für Volkskunst wird mit seinen Publikationsmitteln die Bemühungen der Kreise und Bezirke ständig unterstützen und für die Verbreitung der „Woche der Volkskunst“ und der „Festtage der Volkskunst“ in Berlin durch Presse, Funk und Fernsehen aber auch durch Diapositive für die Lichtspielhäuser in der Republik sorgen. Den Volkskunstkabinetten und Bezirkshäusern für Volkskunst entsteht die gleiche Aufgabe in ihren Kreisen und Bezirken für die Publizierung ihrer eigenen Programme und der zentralen Vorhaben zu sorgen.“[95] Das Zentralhaus wurde als Sprachrohr verstanden, welches mit den vorhandenen Medien zusammenarbeiten sollte, um sich Gehör zu verschaffen. Wie die Quelle zeigt, war es nicht nur dafür verantwortlich, nach „unten“ zu delegieren, sondern auch den eigenen Einfluss geltend zu machen und die Belange der Bezirkshäuser und Volkskunstkabinette durch die Presse bekannt zu machen. Regionale Veranstaltungen der „kleinen Häuser“ sollten durch das Zentralhaus die notwendige Öffentlichkeit bekommen. Das „Medium Zentralhaus“ fungierte also in beide Richtungen. Es gab Anordnungen von oberer Stelle nach unten weiter und verrichtete Öffentlichkeitsarbeit für die unteren Instanzen, damit sie „oben“ Beachtung fanden und Unterstützung erhielten. Die Volkskunstkabinette und Bezirkshäuser konnten sich das Zentralhaus zum Vorbild nehmen und sich an dessen Aufgabenbereichen für die eigene Arbeit orientieren. Maßnahmen, die im Zentralhaus vollzogen wurden, dienten den untergeordneten Häusern als Beispiel, um sie auf ihren kleineren Territorien anzuwenden. BRD - Freund und Feind zugleich Das Verhältnis zur Bundesrepublik Deutschland zeichnete sich durch eine auffällige Ambivalenz aus. Der Kontakt zu westdeutschen Volkskunstgruppen wurde beständig gesucht und gefördert, zugleich wurden das System und die Bonner Regierung verurteilt und verunglimpft. Durch die feindliche Einstellung zur Bundesdeutschen Regierung und die Ablehnung derselben versuchte die DDR, sich vom Faschismus abzugrenzen. Jean Mortier formuliert diese Taktik wie folgt: „Die faschistische Vergangenheit der eigenen Bevölkerung wurde ausgeblendet und die „Erblast“ nach Westen entsorgt, das heißt auf den anderen deutschen Staat abgewälzt.“[96] Somit konnte man sich selbst auf die moralisch erhöhte Position des Kritikers erheben. In den Fünfziger Jahren war der Wunsch nach einem vereinten Deutschland noch sehr groß und nach dieser Maxime wurde gehandelt. Als Richtlinie während der Gründung des Zentralhauses für Laienkunst hieß es: „Die deutsche Kultur endet nicht an der Zonengrenze, das Zentralhaus für Laienkunst arbeitet für ganz Deutschland, auch für die vernachlässigten und gehemmten Künstler in Westdeutschland. Es soll als Unterpfand für die kommende Einheit Deutschlands stehen.“ [97] Das Zentralhaus verstand sich als kulturelle Vertretung des gesamten deutschen Volkes. Um die gewünschte sozialistische Ideologie in Westdeutschland zu verbreiten, sollte das Zentralhaus auch dort tätig sein. So widersprüchlich dieses ambivalente Verhältnis zur Bundesrepublik Deutschland scheint, so verfolgte es doch ein Ziel. Die Annäherung an die volkskunstschaffenden Arbeiter und das bemühte brüderliche Verhältnis sollten, ebenso wie die Propaganda gegen die Regierung, die DDR als den besseren Staat, insbesondere für die arbeitende Bevölkerung, hervorheben. Die Volkskunst galt in der DDR als verbindendes Element zwischen den Arbeitern aus Ost- und Westdeutschland und wurde als solches propagiert. Auf den ersten Festspielen am 22.4.1952 äußerte sich „Kollege Blanke“ vom Zentralhaus: „Die Volkskunst spielt eine entscheidende Rolle für die Wiedervereinigung.“[98] Anfang der Fünfziger Jahre wurde noch in gesamtdeutschen Maßstäben geplant. Neben dem Wunsch nach der baldigen Wiedervereinigung, wie er in den Quellen zu erkennen ist, wurden auch vorgegebene Formulierungen der SED verwendet, die den Optimismus auf die Wiedervereinigung schüren sollten. Eine Schrift zur Vorbereitung der Deutschen Festspiele der Volkskunst besagt: „Es muss eine Hauptaufgabe sein, den Kollegen in Westdeutschland den Friedensvorschlag nahe zu bringen. Sie müssen spüren, dass in der DDR Millionen Menschen an ihrer Seite stehen.“[99] Es ging in der ostdeutschen Propaganda für Westdeutschland auch darum, die eigene Seite als besserer Vertreter der Volkskunst für alle Deutschen darzustellen. Die Zusammenarbeit mit Westdeutschland wurde als Möglichkeit wahrgenommen, Teile der Bevölkerung auf die „richtige Seite“ zu ziehen. Volkskünstler mit der „richtigen“ Gesinnung wurden als Brüder betrachtet. Ihnen wurde Unterstützung zugesagt und somit konnte man hoffen, die Opposition in der Bundesrepublik gegen das kapitalistische System zu stärken. Besondere Verbindungen sollten zu den Arbeitern im Ruhrgebiet hergestellt werden, da man sich von den Kumpeln dort aufgrund ihrer Tätigkeit und Situation im Arbeiterleben eine ähnliche Geisteshaltung versprach. Die Kontaktaufnahme war vielfältig. Bei der Fachtagung der Volks- und Laienkunst Ostern 1952 in Berlin appellierte Werner Kühn: „Brieflicher und persönlicher Erfahrungsaustausch zwischen westlichen und östlichen Gruppen, Beteiligung westdeutscher Wissenschaftler an der Arbeit im Zentralhaus für Laienkunst durch Forschungsaufträge, gemeinsame Herausgabe von Werken über die deutschen Volkstrachten, Bräuche, Handwerke, Volksliederbuch, Volkstanzsammlung, Auftrag an je drei west- und ostdeutsche Schriftsteller und Komponisten und gemeinsame Schaffung eines Werkes über Leben und Arbeit der Kumpel im Ruhrgebiet sei zu erreichen.“[100] Zu Beginn der Fünfziger Jahre war das Verhältnis zu den westdeutschen Volkskunstgruppen noch von Sympathiebekundungen geprägt. Überschwänglich und nahezu anbiedernd wurden die gemeinsame Haltung und die verbindenden Elemente gepriesen. Das Verhältnis erhielt im Laufe der Fünfziger Jahre jedoch einige Risse. In der Praxis ließen sich viele Vorhaben nicht so einfach erfüllen, die Skepsis wuchs. Die Aufzeichnungen des Zentralhauses lassen Rückschlüsse darauf zu, dass die westlichen Volkskunstgruppen zwar auch die Zusammenarbeit suchten, aber nicht mit dem Ziel, den eigenen Staat zu „verraten“ und den Sozialismus zu feiern. Dieses Phänomen gab es zwar auch, es war aber auf einzelne Arbeiter beschränkt. Solche Äußerungen wurden dokumentiert und als Triumph des Zentralhauses betrachtet. Der Diskussionsbeitrag der westdeutschen Delegation, die von „Kollege Paulus“ vertreten war, stellte sich 1954 wie folgt dar: „Ich will nicht darauf eingehen, unter welchen Bedingungen wir in Westdeutschland arbeiten müssen, aber wir arbeiten und wir können arbeiten, weil wir Sie haben, weil wir die DDR haben. Diese Tatsache gibt uns immer wieder neuen Schwung, neue Zuversicht. […] Viele Tausende Volkskunstschaffende Westdeutschlands wissen vom Bestehen des Zentralhauses für Laienkunst in Leipzig. Wir, die Delegation der fortschrittlichen und friedliebenden Vertreter der Volkskunstschaffenden Westdeutschlands erklären im Namen all unserer Freunde anlässlich dieser Konferenz, dass wir im Zentralhaus für Laienkunst ein Institut sehen.“[101] Solche Aussagen bestätigten das Zentralhaus in seiner Selbstwahrnehmung. Es sah sich als Institut, das nicht nur die Volkskunst in der DDR anleitete, sondern das auch in der Bundesrepublik Deutschland bekannt und geschätzt war. Es bestärkte die Mitarbeiter des Zentralhauses in der Überzeugung, dass sie die Volkskünstler in der BRD unterstützen und retten müssten. Die DDR empfand gegenüber der Bundesrepublik auf dem Kulturgebiet Überlegenheit. Trotz wirtschaftlich schlechter Verhältnisse wurde Kultur in der DDR stärker gefördert als in der Bundesrepublik Deutschland. Mitte der Fünfziger Jahre gab die DDR, gemessen an der Zahl der Einwohner, etwa doppelt soviel Geld für kulturelle Einrichtungen aus wie die BRD.[102] Insofern konnte sich die DDR mit der Behauptung rühmen, Kultur als wichtiger zu erachten als die Bundesrepublik und auch in Zeiten, in denen die Finanzen knapp waren, nicht an der kulturellen Bildung zu sparen. Das sozialistische System stilisierte sich selbst zum Vorbild. In der Hoffnung auf Anerkennung und Nachahmung ihres Systems arbeitete die DDR mit den Volkskünstlern der BRD zusammen. Dieser Eindruck ließ sich jedoch nicht lange aufrechterhalten. Die Leiter der Abteilungen erlangten in Diskussionen zunehmend die Erkenntnis, dass ein gemeinsames Arbeiten mit Westdeutschen nicht mit einer Gleichschaltung von deren Gesinnung zu verwechseln ist. Auf einer Arbeitskonferenz des Leitungskollektivs des Zentralhauses für Volkskunst im Februar 1956 wurde dies zwischen den Anwesenden diskutiert. Dr. Nedo stellte fest, dass dies die erste gemeinsame Beratung sei, die zwischen dem Zentralhaus für Volkskunst und den westdeutschen Wissenschaftlern in freundschaftlicher Atmosphäre stattfand. „[…]Unsere Beziehungen zum Deutschen Volksmusikarchiv haben sich verschlechtert. […] Die Wissenschaftler sind im Westen keine Marxisten, sind aber bereit, mit uns zusammenzuarbeiten. Auf jeden Fall sind es hervorragende Fachleute. Wie muß man mit ihnen verkehren? Mit Ehrlichkeit und Offenheit, mit persönlichem Vertrauen und fachlicher Qualität von unserer Seite.“[103] Dr. Nedo offenbarte sich hier wiederholt als Experte, der nicht vorrangig als ideologischer Hardliner zu sehen ist. Er betrachtete die Realität und machte sich keine falschen Hoffnungen über die Haltung der westdeutschen Volkskunstgruppen. Da sie aber aus fachlicher Perspektive für die Volkskunst der DDR von Vorteil sein konnten, war er weiterhin an Kontakt interessiert. Diese Haltung wurde nicht von allen Mitarbeitern des Zentralhauses geteilt. Mangelndes ideologisches Auftreten war für den Großteil der Mitarbeiter ein Ausschlussgrund. Die Reaktion von Fritz Pötzsch ist von jener anderen Prioritätensetzung bestimmt: „Es soll ein Volkstanzfest der DDR mit westdeutschen Gästen stattfinden. […] Es sollen keine Gruppen in Massen kommen, sondern nur erste Qualität, verbunden mit ideologischer Klarheit, also weniger und besser!“[104] Das Zentralhaus entschied über die Art der Kontakte. Treffen zwischen west- und ostdeutschen Gruppen, die ohne die Kenntnis des Zentralhauses geplant wurden, galten als illegal. „Es wird gebeten, illegale Einladungen an Chöre der DDR aus Westdeutschland und umgekehrt umgehend der STAG oder dem Zentralhaus für Volkskunst bekannt zu geben, damit von da betreffend gesamtdeutscher Arbeit entschieden werden kann.“[105] Dieser schärfere Ton wurde im Jahr 1959 angeschlagen. Der Kontrollwunsch des Zentralhauses ist offensichtlich. Allerdings geht die Anschuldigung der illegalen Aktivität an die westlichen Gruppen. Die Aussage erweckt den Eindruck, dass bei solch illegalem Verhalten des Westens sofort Meldung erstattet werden sollte, damit die ostdeutschen Volkskunstgruppen geschützt werden können. Die Abgrenzung gegen den Westen sollte die ostdeutschen Volkskünstler noch enger zusammenbringen. So wurde auch zunehmend Kritik an der Arbeitsweise der westdeutschen Kunst laut. Die Auswertung des 7. Verbandtages des Verbandes der Heimat- und Volksbühnenspieler Bochum ließ nicht mehr auf brüderliche Einigkeit schließen: „Teilnahme als Vertreter für das Zentralhaus für Volkskunst: Christa Fischer und Gerhard Otto: Bewertung: Volksbühnenspieler in Bochum sind die niveauloseste Gemeinschaft, die es in der BRD gibt. Es war eine miserable Darstellung mit faschistischen Aussagen. Starke Kritik an Leiter Paul Herder. Dennoch wird die Zusammenarbeit mit anderen Laiengruppen in der BRD empfohlen, sogleich aber auch um eine Klärung des Charakters der gesamtdeutschen Arbeit gebeten.“[106] Auch der Ton der BRD gegenüber der DDR verschärfte sich. Achim Fleischer, BRD, an Dr. Albin Fritsch, DDR, 28.8.59 [beide offenbar Leiter von Tanzgruppen]: „[…] Was ist bei Ihnen eigentlich los? Vor ein paar Tagen erhielten wir von Herrn Brühl aus Meiningen die feste Zusage, dass die Genthiner und Halberstädter Tanzkreise mit ca. 60 bis 70 Personen an unserem Tanzfest teilnehmen würden.[] Umso erstaunter und verärgerter sind wir aber nun, weil uns vor einer halben Stunde – also genau eine Woche vor unserem Tanzfest[…] ein Telegramm aus Halberstadt erreicht, dass die Gruppe nicht kommen könne, das sie angeblich nicht einsatzbereit sei.[…] Sollte das gleiche Theater wie im vergangenen Jahre wieder losgehen, sehen wir uns endgültig gezwungen, jeden Kontakt mit den Gruppen aus der DDR abzubrechen.[…]“[107] Die Geduld beider Parteien nahm ab, das Verständnis für die problematischen Umstände ebenso, und der Umgangston wurde gereizter. Das Zusammengehörigkeitsgefühl der Arbeiter in beiden deutschen Staaten ließ nach und das Element der Volkskunst, welches verbinden sollte, überdeckte nicht mehr die Gegensätze. Die bedeutendste Zusammenarbeit zwischen Ost und West auf dem Gebiet der Volkskunst waren die Wartburgtreffen, die vom Zentralhaus veranstaltet wurden. Der Verlauf der stetig schlechter werdenden Beziehungen lässt sich anhand der Wartburgtreffen illustrieren. Um deren Entwicklung chronologisch aufzuzeigen, ist an dieser Stelle ein Rückblick in die frühen Fünfziger Jahre angebracht. Die Teilnahme der westdeutschen Volkskunstgruppen an den Wartburgtreffen wurde von der DDR-Spitze als Befürwortung ihrer Politik gesehen. So lautete eine Rede zur Konzeption des III. Wartburgtreffen von Walter Ulbricht in Leipzig: „[…] trotzdem sucht DDR nach Verständigung, Frieden und Einheit, was bei den Werktätigem und der Intelligenz in Westdeutschland Widerhall findet. Die Volkskunstschaffenden Westdeutschlands setzten sich gegen die Pariser Verträge zu Wehr. Es werden 12.000 Sänger aus Westdeutschland zum III. Wartburgfest erwartet.“[108] Im Nachhinein ist in einer Rede von „Kollege Pötzsch“ festgehalten, dass nur 7000 westdeutsche Sänger teilnahmen. Dies wurde aber trotzdem als Zeichen der deutschen Einheit angesehen. Es wurde erklärt, dass das Wartburgfest eine Gelegenheit ist, dem Westen zu beweisen, wie gut sich die Volkskunst in der DDR entwickelt. Hierin zeigte sich bereits der Gedanke des Wettkampfs mit den Volkskunstschaffenden der BRD. Die Feindseligkeit gegenüber der westdeutschen Regierung wurde zwar nie geleugnet, allerdings sollten die Volkskunstschaffenden als Freunde empfangen werden. Hier wurde nun erstmals der Wunsch ausgedrückt, ihnen gegenüber auftrumpfen zu können. 1957 wird beschlossen, dass 1958 beim Wartburgfest vorwiegend DDR-Chöre auftreten sollen und nur Delegierte der Chöre aus Westdeutschland eingeladen werden.[109] An dieser Maßnahme und dem sich im Briefverkehr verändernden Ton kann man den Bruch erkennen, der zwischen den Organisationen der Volkskunst in West- und Ostdeutschland stattgefunden hat. 1958 lässt sich sogar eine Abkehr von dem Gedanken der Wiedervereinigung erkennen, den die Volkskunst bislang vorantreiben sollte: „Die vier vorherigen Wartburgfeste standen im Zeichen der Wiedervereinigung. Der Verkehr unsererseits war von größtem Vertrauen und Loyalität gekennzeichnet. Seit den vierten Wartburgfesten hat sich die politische Situation verschärft, in Westdeutschland werden demokratische Freiheitskräfte immer mehr geknebelt und der Faschismus zeigt sein wahres Gesicht. An alle, die sich gegen Terrorjustiz der westdeutschen Bundesrepublik und für eine glückliche sozialistische Zukunft Deutschlands kämpfen, geht die Einladung.“ [110] Mit dieser Aussage war jeder westdeutsche Volkskünstler, der am V. Wartburgtreffen teilnehmen wollte, dazu gezwungen, sich offen gegen die BRD zu stellen und das Rechtssystem als Terrorjustiz anzuprangern. Die diplomatischen Bemühungen des Zentralhauses wurden zu diesem Zeitpunkt endgültig begraben. Der Sozialismus wurde als das einzige Gegenkonzept zum faschistischen Kapitalismus in der BRD aufgezeigt. Sowjetunion – Das große Vorbild Die Vorgaben des Zentralhauses waren klar: Es galt, der Volkskunst der Sowjetunion nachzueifern. Ob diese Forderung aber tatsächlich die Haltung der Menschen beeinflusst hat, lässt sich nicht anhand der offiziellen Unterlagen des Zentralhauses überprüfen. Die Differenz zwischen dringenden Appellen und deren Wirkungsweise auf die Bevölkerung muss in einer Arbeit, die sich mit dem Institut und dessen Arbeit beschäftigt, ausgespart bleiben. Das Thema würde sich sonst auf die Volkskunst im Allgemeinen und auf die psychologische Befindlichkeit der Menschen in der DDR ausbreiten, was zu weit vom Kern der Arbeit entfernt ist. Fest steht aber, dass die Sowjetunion in der DDR als der „große Bruder“ propagiert wurde. Das ostdeutsche Volk sollte zur Freundschaft mit der Sowjetunion erzogen werden. Dies galt als Ziel der Volkskunst, das vom Zentralhaus schon in den Zeiten der Gründung, aber auch in den folgenden Jahren immer wieder betont wurde.[111] Die Volkskunst der Sowjetunion sollte der DDR als Vorbild dienen. Die Vorgaben des Zentralkomitees an das Zentralhaus enthielten folgenden Auftrag: „Wenn früher vor allem die Verbreitung der Wahrheit über den Sozialismus in der Sowjetunion und den Übergang zum Kommunismus erfolgte, so steht jetzt die Aufgabe, die Erfahrungen des Kampfes um den Sozialismus in der Sowjetunion genau zu studieren, damit wir die Lehren in der DDR verwirklichen können.“[112] Häufig war die Freundschaft mit der Sowjetunion Thema auf Lehrgängen und auch Gegenstand der Kunst an sich. Liedtexte, aber auch Motive auf Bildern stellten die russische Lebensweise dar. Diese Formen der Kunst wurden vom Zentralhaus gefördert und ausgezeichnet. Das Verhältnis zwischen Sowjetunion und DDR zeichnete sich durch Solidarität untereinander und mit den anderen östlichen Staaten aus. So finden sich zahlreiche Artikel in den Unterlagen des Zentralhauses über das Chorfestival in Nordrhein-Westfalen vom 13.7.1955. Dieses Festival wurde von der DDR als Eklat empfunden. Ein eingeplanter Chor aus der Sowjetunion wurde von den westdeutschen Veranstaltern gestrichen, was wiederum den Chor aus Ostberlin dazu veranlasste, ebenfalls nicht aufzutreten.[113] Die beiden sozialistischen Staaten präsentierten sich als eine Einheit. Die Tatsache, dass von den Volkskünstlern der DDR solch ein Verhalten erwartet wurde und dann auch von den Leitern der Gruppen beschlossen wurde, bedeutet nicht, dass sich die Volkskünstler der DDR mit der sowjetischen Lebensweise identifizierten, aber die lenkende Rolle des Zentralhauses wird an diesem Beispiel offensichtlich. Inhaltliche Ansprüche des Zentralhauses in der Kulturpolitik der Fünfziger Jahre Durch alle Tätigkeitsfelder des Zentralhauses zog sich eine Linie. So mannigfaltig die Bereiche des Instituts auch waren, inhaltlich ähnliche Ansprüche lassen sich auf allen Gebieten finden. Mit diesen inhaltlichen Schwerpunkten wird sich der folgende Teil der Arbeit beschäftigen. In der DDR sollte eine neue, vorrangig von den Arbeitern und Bauern getragene Form von Kultur entstehen. Ein Ziel war die Entwicklung der sozialistischen Intelligenz aus den Reihen dieser Bevölkerungsschichten. Seit Beginn der Fünfziger Jahre gab es Verordnungen, die einen zumindest 60%igen Anteil von Arbeiter- und Bauernkindern unter den Schülern der Oberschulen und Universitäten festlegte. Die Kultur der Sowjetunion hatte großen Einfluss; der Stalinkult wurde auch in der DDR betrieben.[114] Stalins Tod und das in der Sowjetunion einsetzende „Tauwetter“ wirkten sich, wenn auch in verringerter Form, auf die DDR aus. Ulbricht verhinderte zwar eine weit reichende Entstalinisierung, dennoch kam es in der Kulturpolitik zu Lockerungen der dogmatischen Richtlinien. Erziehung als oberste Priorität Jegliches Handeln der SED-Führung stand unter der Prämisse, den „neuen Menschen“ zu schaffen. Dieser „neue Mensch“ sollte von den Idealen des Sozialismus durchdrungen sein. Auch die Vorgaben des Zentralkomitees vom 26.7.1953 bezüglich der Volkskunst sind eindeutig:„Auf dem Gebiet der Kultur besteht der neue Kurs in der weiteren Pflege des nationalen Kulturschaffens […] wobei darauf geachtet werden muss, dass die Künstler und Schriftsteller von den Auffassungen der Partei über die Entwicklungswege von Kunst und Literatur geduldig überzeugt und diese Auffassungen ihnen in keinem Falle administrativ aufgezwungen werden.“[115] Hier steht einmal mehr der erzieherische Gedanke im Vordergrund. Die Verwandlung zum neuen Menschen sollte keine oberflächliche sein, sondern eine grundlegende. Die Hoffnung, dass sich die Künstler und Schriftsteller ohne administrativen Zwang und durch Geduld zur richtigen Überzeugung bekennen würden, bewahrheitete sich im Laufe der Jahre nicht. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass durch Auftrittsverbote für Volkskunstgruppen administrativer Druck ausgeübt wurde. Zum größten Teil wurde aber versucht, durch erzieherische und anleitende Methoden die Künstler zur bevorzugten Kunstform zu führen. Die SED-Spitze interessierte sich dementsprechend in erster Linie für die ideologischen Fortschritte, die in der Volkskunst gemacht wurden. Simone Hain beschreibt die Formung des „neuen Menschen“ in der Volkskunst. Auf der Suche nach der Struktur des neuen Systems sollte die Entfremdung der Individuen von Gesellschaft, Arbeit und Natur aufgehoben werden. Die Laienkunst erlebte eine Renaissance, die einen Umfang erreichte, die auch von ihren Initiatoren so nicht erwartet worden war. Hain geht davon aus, dass die Dynamik der Volkskunst sich mit Verengung und Dominanz der Politik verstärkte.[116] So stark die Volkskunst auch von Vorgaben durchzogen war, bot sie doch die Möglichkeit nach kreativer Entfaltung. Durch die Zirkel bot die Volkskunst gesellschaftliches Leben und Ablenkung vom Arbeitsalltag. Je unzufriedener die Menschen mit der politischen Situation waren, umso stärker war das Bedürfnis nach Zerstreuung durch ein Hobby. Zum zweijährigen Bestehen sandte das Zentralhaus für Laienkunst einen Brief an Ministerpräsident Otto Grotewohl, in dem es sich für die großzügige Förderung und Unterstützung bedankte. Des Weiteren informierte es den Ministerpräsidenten darüber, dass die „systematische Erziehungs- und Bildungsarbeit in den Klubs und Kulturhäusern und stetige Leistungssteigerung dazu beitragen wird, dass die Volkskunst gegen ideologische Kriegsvorbereitung des amerikanischen Imperialismus geschützt wird und seinen westdeutschen Handlangern entgeht.“[117] Das Zentralhaus für Laienkunst versprach, dass die Volkskunst zu einer immer stärkeren „Waffe im politischen Kampf des deutschen Volkes werden wird.“[118] Der Brief erwähnt nur den erzieherisch-ideologischen Auftrag. Der fachlich-methodische Ansatz, wegen dessen das Zentralhaus laut eigener Aussage gegründet wurde, wird mit keinem Wort erwähnt. Die künstlerischen Fähigkeiten auszubauen war nicht primäres Interesse des Zentralhauses und des Zentralkomitees. In den Bewertungen der Veranstaltungen gilt der größte Teil immer der ideologischen Haltung der Volkskünstler und der Veranstaltung insgesamt. Zumeist ging der Bewertung noch eine Erläuterung voraus, warum sich nur in einem sozialistischen System Kunst entfalten kann: Angeblich würde der Sozialismus die Kunst nicht zum Gebrauchsgegenstand umfunktionieren, der seine Berechtigung erst durch ökonomischen Nutzen erhielte. Diese Haltung gründete sich laut Zentralhaus vor allem auf die kunstfeindliche Wirkung des Kapitalismus: „1. Das Erzeugnis der bildenden Volkskunst wird zur Ware, zum Objekt der kapitalistischen Profitsucht eingespannt in die tödliche Zange von Angebot und Nachfrage, das künstlerische Schaffen ist mit der Existenzfrage verknüpft 2. Der Volkskünstler wird zum Lohnarbeiter, da er maschinell Riesenmengen von Gegenständen herstellt 3. Es wird nur der Nutzen und die Funktion von Dingen gewürdigt“[119] Demnach nutzte die BRD die Volkskunst für unlautere, ökonomische Ziele. Die Volkskunst in der DDR sollte aber durchaus auch eine Funktion erfüllen, auch wenn diese nicht kapitalistischer Natur war. In der DDR wurde die Volkskunst politisiert. Die Menschen sollten sich durch volkskünstlerische Tätigkeiten zum Sozialismus bekennen und enger an das System gebunden werden. Hier steckte eine ideologische Instrumentalisierung hinter der vom Zentralhaus propagierten Kunstform. Aus dem verkündeten Antifaschismus war schon lange ein Antikapitalismus und Antiamerikanismus geworden.[120] Diese, in der DDR als logische Konsequenz verbreitete, Veränderung der Ideologie schuf ein real existierendes Feindbild, gegen das man sich abgrenzen musste und konnte. Abgrenzung von Anderen bot die Chance auf stärkere Identifikation mit der eigenen Gruppe und Intensivierung mit der Solidarität der Gemeinschaft. Die anleitenden Schriften beginnen stets mit einem Aufruf zur Verbreitung des Sozialismus. Durch die Förderung der Volkskunst und die ideologische Beeinflussung, die das Zentralhaus auf die Volkskunstgruppen auszuüben versuchte, sollten diese Bevölkerungsgruppen an den Staat und die politischen Ziele gebunden werden. Die Kunst in der DDR sollte sich vom Konsumverhalten der BRD abgrenzen. Es galt die Annahme, dass Arbeiter, die vom Staat eingebunden und gefördert werden, sich mit diesem identifizieren und sich ihm gegenüber loyal verhalten. Privilegien für Volkskunstschaffende, die die richtige Gesinnung darstellten, konnten „als Mittel der Differenzierung und Disziplinierung“[121] eingesetzt werden. Künstlerischer Anspruch So bestimmend der ideologische Anspruch auch war, darf man daraus nicht schließen, dass die Qualität der Kunst unbeachtet blieb. Allerdings gab es keine einheitliche Meinung zu diesem Thema. Während gemeinhin der künstlerische Anspruch nicht die meiste Beachtung bekam, gab es auch immer wieder Stimmen, die die Aufmerksamkeit auf die Kunst selbst lenkten. Es gab die Forderung, dass die künstlerischen Fähigkeiten in den Zirkeln und durch Veröffentlichungen des Zentralhauses geschult werden sollten. Schließlich müsse die Volkskunst die DDR repräsentieren und demonstrieren, dass Arbeiter mit der richtigen Förderung zu künstlerischen Höchstleistungen fähig sind. Der Anspruch des Zentralhauses an die künstlerischen Fähigkeiten stieg mit den Jahren. Direkt nach Gründung im Jahr 1952 wurden relativ geringe Ansprüche im Protokoll der Leitungssitzung erhoben: „Auf ein Mindestmaß handwerklich-fachlicher Gestaltungsfähigkeit kann nicht verzichtet werden, das kommende Bildmaterial wird vom Zentralhaus für Laienkunst ausgewählt.“[122] Im gleichen Atemzug wurden das hohe Klassenbewusstsein und die unmittelbare Lebensnähe der Arbeiter mit der Formulierung „es sei keine Postkartenpinselei“[123] gelobt. Wobei hier doch die Frage gestellt werden muss, ob nicht das gelobte Klassenbewusstsein und die Lebensnähe ideologische Werte sind, die den künstlerischen Wert unerwähnt lassen. Nur weil ein Bild Klassenbewusstsein und Lebensnähe enthält, kann es immer noch „Postkartenpinselei“ sein. Es wird davon ausgegangen, dass „Postkartenpinselei“ als abwertender Terminus für Malerei ohne künstlerische Qualität benutzt wurde. Hier wurde also die ideelle Vorstellung mit der künstlerischen Fähigkeit gleichgesetzt oder zumindest durch ungenaue Formulierung vermischt. Es wurde aber auch mitunter das tatsächliche künstlerische Niveau der Gruppen beurteilt. Insbesondere Dr. Nedo erschien der künstlerische Aspekt der Darbietungen keineswegs zweitrangig. Sowohl seine Arbeit im Zentralhaus als auch die Arbeit in dem angegliederten Institut für Volkskunstforschung und deren Prioritätensetzung auf wissenschaftliches Arbeiten bestätigen diesen Eindruck. Es wurde aber auch an anderer Stelle auf die künstlerischen Fähigkeiten der Laienschaffenden eingegangen. Der stellvertretende Minister Prof. Pischner kritisierte die mangelnden musischen Fähigkeiten. „[…] Eine weitere Schwäche, die bei einer Anzahl von Kapellen im Niveau zu bemerken ist, besteht darin, dass Freunde mitspielen, die über keine oder nur sehr unzulängliche Notenkenntnisse verfügen.“[124] Einerseits bezeugt dieser Kommentar, dass die künstlerischen Fähigkeiten durchaus nicht in allen Volksgruppen ausgeprägt waren, denn eine Kapelle, deren Mitglieder nicht über Notenkenntnisse verfügen, fehlen die elementarsten Grundkenntnisse, und sie kann nicht zur Meisterschaft gelangen. Andererseits zeigt der Kommentar, dass solche Mängel wahrgenommen und thematisiert wurden, um sie zu beheben. Der künstlerische Anspruch spielte eine Rolle, wenn auch nicht die Hauptrolle. Im Vordergrund stand die Ideologie, und diese wurde von der Partei vorgeschrieben und spiegelte sich laut SED nur in ausgewählten künstlerischen Stilmitteln wieder. Pischners Referat äußerte sich bei einer vom Zentralhaus veranstalteten Konferenz 1962 wie folgt: „[…] Ich möchte sagen, dass in unserer DDR selbstverständlich der Jazz nicht grundsätzlich abgelehnt wird; aber andererseits sind wir der Meinung, dass man ihn in der richtigen Weise auch in unser Musikleben einbezogen hat. […] Es ist ja bekannt, dass er sich aus der Folklore der Neger der USA entwickelte und anfänglich – ich betone, anfänglich – zum Teil selbst noch folkloristischen Charakter hat und in manchem auch wohl kritische Züge trug, aber man muss erkennen, dass bereits auch mit dem Entstehen des Jazz der Prozess seiner Dekadenz begann.“[125] Der folkloristische Charakter des Jazz wurde also toleriert, die amerikanische Dekadenz, die ihm vorgeworfen wurde, hingegen verurteilt. Durch die Behauptung, Teile des Jazz in die Musik der DDR aufgenommen zu haben, wurde aber Weltoffenheit postuliert. Die Weiterentwicklung des Jazz wurde als unvereinbar mit sozialistischen Werten verworfen, die Dekadenz mit Formalismus und Bürgerlichkeit gleichgesetzt und widersprach somit den Ansprüchen der sozialistischen Lebensweise. Ulbricht persönlich propagierte diese Haltung im „Neuen Deutschland“, einem der wichtigsten Sprachrohre der DDR: „Mit formalen, dekadenten oder so genannten modernistischen Gestaltungsmitteln, die aus der spätbürgerlichen Kunst entnommen werden, kann man keine Werke schaffen, die das sozialistische Denken und Fühlen der Werktätigen bereichern, d.h. keine im eigentlichen Sinne sozialistische Kunst.“[126] Das Zentralhaus richtete seine Arbeit auf die Produktion realistischer Kunst aus. Eine Kunstform, die das Zentralhaus entwickelte und besonders förderte, war die „kleine Form“. Der Ausdruck „kleine Form“ bezog sich auf den Umfang des darzubietenden Werkes und der Anzahl der Aufführenden. Der „kleinen Form“ wurde eine aktivierende Wirkung auf Zuschauer und Ausübende zugeschrieben. Sie galt als besser abgestimmt auf die künstlerischen Begabungen der Werktätigen.[127] Das Attribut des Kleinen sollte die Hemmschwelle des Arbeiters, sich mit Kunst zu befassen, abbauen. Die „kleine Form“ verkörperte Simplizität und Kunst für jedermann. Diese Einstellung vertrat Prof. Helmut Koch in seiner programmatischen Erklärung für eine sozialistische Volkskunstbewegung im Juni 1957:„[…] In den fernsten Dörfern unserer Republik gibt es Menschen, denen die Aufführung von „Des Erbförsters Töchterlein“ nicht mehr gefällt. Sie fragen die Schriftsteller: Warum gebt Ihr uns nicht kleine Stücke, möglichst mit Musik, die von unserem Leben handeln, die wir spielen können und die uns auch Spaß machen?“[128] Ob die Menschen in den Dörfern tatsächlich nach dieser Form verlangten, kann nicht nachgeprüft werden. Offensichtlich ist aber, dass die „kleine Form“ einen Realismus forderte, der sich auf das Leben der Arbeiter und Bauern beziehen sollte. Diese Form des Realismus stand in Abgrenzung zum bürgerlichen Realismus. Die betrachtete Schicht des sozialistischen Realismus ist für die Abgrenzung ausschlaggebend. In der „Kleinen Form“ wurde der sozialistische Realismus gefordert, ohne ihn direkt zu benennen. Das Zentralhaus veröffentlichte 1955 die Materialsammlung „Kleine Form“ im künstlerischen Volksschaffen, in der sie die Besonderheiten dieser Kunstform darlegte. Diese sind hier in zwei Hauptpunkten zusammengefasst: „1.Die Art der Bearbeitung, die es verstehen muss, mit wenig Mitteln den vollen Charakter des Liedes verständlich und fühlbar zu machen 2. Der Zweck des Einsatzes von kleinen Formen: Es gibt die große Gefahr, die „Kleine Form“ um ihrer selbst willen zu pflegen. Sie ist wichtig für die Erhöhung der kulturpolitischen Wirksamkeit, für die Entwicklung neuer Kader und für die Überwindung technisch-organisatorischer Schwierigkeiten.“[129] Diese Materialsammlung ist aber bei weitem nicht die einzige Informationsquelle zum Thema „Kleine Form“. In den Materialien des Zentralhauses finden sich zahlreiche Aufsätze, das Thema erörtern. Einzelne Sitzungen der Kollektive widmeten sich nur der Definition dieser Thematik. Das Zentralhaus legte offenbar große Hoffnung in dieses künstlerische Konzept, um die Arbeiter zur künstlerischen Produktion zu motivieren. Aus dem Konzept ist ersichtlich, dass der Anspruch an die Volkskunst nichts „Großes“ forderte. Die künstlerische Qualität war, auch wenn gelegentlich das Gegenteil verkündet wurde, nicht mit hoher Kunst zu vergleichen. Der Terminus „kleine Form“ weist auf die Grenzen der Kapazitäten der Volkskunst hin. Die Bezeichnung „klein“ ist sowohl für die Länge, als auch für die inhaltliche Tiefe der Werke zu verstehen. Ständiger Rechtfertigungsdruck In den bisherigen Ausführungen ist bereits erwähnt worden, dass die Abteilungen des Zentralhauses nicht immer gut zusammenarbeiteten. Sie standen in gewisser Weise in Konkurrenz zueinander, denn jede Abteilung musste ihre Existenz immerzu rechtfertigen. Weil der Druck, sich durch die eigene Kunstform als unersetzbar für den Aufbau des Sozialismus zu erweisen, so enorm war, begannen die Berichte der Abteilungen über etwaige Veranstaltungen mit ausladenden Ausführungen über die unverzichtbaren Auswirkungen ihres Fachgebietes. In diesen Ausführungen konnte man zum Teil haarsträubende Begründungen für den sozialistischen Charakter der einzelnen Künste finden. So konnten sich Theater und schreibende Zirkel auf ihre inhaltliche Beschäftigung mit dem Sozialismus berufen. Sie schrieben Stücke, Romane und Lyrik über den Aufbau des Sozialismus und leisteten somit ihren Beitrag zu dessen Umsetzung. An der gleichen Argumentation versuchte sich das Puppenspiel.„Dabei soll erneut bewiesen werden, dass das Puppenspiel ein unentbehrlicher Bestandteil im sozialistischen Volkskunstschaffen ist. Mit unseren Möglichkeiten wollen wir die großen Perspektiven unserer sozialistischen Entwicklung aufzeigen, mithelfen bei den großen ökonomischen und politischen Aufgaben unseres Staates, unsere Lehrer und Pionierleiter bei der allseitigen Erziehung unserer Jugend unterstützen.“[130] Diese Begründung ist universell austauschbar: Es könnte jede andere Volkskunst statt des Puppenspiels eingesetzt werden, ohne dass der Text seinen Sinn verliert. Daran kann man die unspezifische Arbeitsweise erkennen. Die meisten Texte beginnen mit solch einer Einleitung, die letztlich nichts Konkretes über die Besonderheiten der Volkskunst in Verbindung mit dem Sozialismus aussagt. In der Chormusik kann man mit sozialistischen Texten argumentieren und in der Bildenden Kunst mit realsozialistischen Abbildungen. Dies beweist aber keinen natürlichen Ursprung der jeweiligen Kunstgattung im Sozialismus. Man könnte alle diese Kunstformen auch mit anderen politischen Inhalten füllen. Die Volkskunst kann Instrument des Sozialismus werden, wenn man sie dafür verwenden möchte. Sie ist aber nicht von Natur aus dazu bestimmt. Als besonders mühevoll hergeleitet erscheinen die Ausführungen der Abteilung Tanz. Während man, wie eben erwähnt, verschiedene Volkskünste als Medium für politische Botschaften verwenden kann, ist dieses Argument beim Tanz etwas schwieriger. Aber obwohl sich beim Tanzen keine Möglichkeit bietet, durch Sprache eine Aussage zu übermitteln, ist Volkstanz trotzdem eine Kunstform. Der erzieherische Anspruch und die natürliche Verbindung zum sozialistischen System waren allerdings schwerer mit ihm zu vereinbaren. Es sei unbenommen, dass Mitglieder von Volkstanzgruppen einen sozialistischen Hintergrund hatten und in den Gruppen sozialistischer Geist herrschte. Ebenso konnte eine solche Gruppe die Zusammengehörigkeit und den sozialistischen Grundsatz „die Gruppe kommt vor dem Individuum“ stärken. Diese Haltung hat ihren Ursprung allerdings in den Funktionsweisen einer Gruppe und nicht in der Kunstform. Mit einem Tanz ein politisches System zu propagieren, erscheint grotesk. Doch wurden entsprechende Begründungen von der Abteilung Volkstanz immer wieder mit Vehemenz angebracht. So wurde in der Auswertung der 9. Tagung des ZK der SED für das künstlerische Volksschaffen verkündet: „[…] Die Volkstanzkonferenz 1960 beschloß, jeder Volkstänzer müsse ein guter Gesellschaftstänzer sein. […] Tanzen ist ein elementares Bedürfnis des sozialistischen Menschen. […] Es liegt auf der Hand, dass diese künstlerische Aufgabe zutiefst politischen Charakter hat und bis in die Produktion wirkt[…]“[131] „Die Produktion des Tanzens“ kann sozialistischen Charakter tragen, wenn die Gruppe sich dazu entschließt oder dementsprechend angeleitet wird. Die Behauptung, dass Tanzen ein elementares Bedürfnis des sozialistischen Menschen sei, entbehrt jeder Grundlage. Diese Argumentation wirkt geradezu lächerlich und wird auch nicht näher erläutert. Eben solche Absurditäten verdeutlichen den Rechtfertigungsdruck, unter dem die Abteilungen sich befanden und ihren sozialistischen Charakter und die erzieherische Wirkung der Volkskunst „nachweisen“ mussten. Ohne erzieherische Wirkung war die Volkskunst in der DDR nicht existenzberechtigt. Selbstfokussierung Das Zentralhaus sollte die Volkskunst betreuen, sich mit dieser beschäftigen, sie anleiten und verwalten. Ein beträchtlicher Teil der Bürokratie beschäftigte sich jedoch mit einem anderen Thema: mit sich selbst. Ein großer Teil der Dokumente des Zentralhauses beschäftigt sich nicht nur mit der Volkskunst, Zirkeln und zu betreuenden Bezirkshäuser und Volkskunstkabinetten, sondern auch mit Referaten, Diskussionen und Abhandlungen über die eigene Tätigkeit. Dieses Kreisen um die eigene Institution nahm viel Zeit in Anspruch. Der Zwang, die eigene Existenz zu rechtfertigen und Gründe zu finden, warum die eigene Arbeit wertvoll für die Volkskunst und die damit verbundene Erziehung zum Sozialismus ist, hat die stetige Beschäftigung mit der eigenen Arbeit und der Ausarbeitung überzeugender Formulierungen zu diesem Thema verstärkt. Die Abteilungen konnten nicht ihre gesamte Energie in die Organisation der Volkskunst fließen lassen, wenn sie permanent ihre Legitimation nachweisen mussten. Eben dieser Umstand verringerte aber wiederum die Effizienz des Zentralhauses. Dazu kam es zu erheblichen Abweichungen zwischen den erwarteten Leistungen der Arbeit und den tatsächlichen Erfolgen. Das Zentralhaus erstellte seine Arbeitspläne quartalsweise. Die groben Aufgabenstellungen gaben die Fünfjahrespläne bereits vor. Sie waren die Richtschnur, nach denen das Zentralhaus sich in seiner konkreten Zielsetzung im Vierteljahr richtete. Darüber hinaus gab es für jede Veranstaltung mindestens einen, oft aber auch mehrere Entwürfe. Nach jeder Veranstaltung folgten eine oder mehrere Analysen und ein Erfüllungsbericht, der den Erfolg der Arbeit beurteilte und mit den Vorstellungen verglich. Selbstverwaltung und Vor- und Nachbereitungen von Aufgabenfeldern einer Institution sind nicht außergewöhnlich. Auch erscheint die Menge der vorhandenen Unterlagen im Vergleich zum gesamten zwar Bestand groß, allerdings fehlt ein Vergleichswert mit einem ähnlichen Institut. Wenn jedoch die Dokumente, die sich mit der Beurteilung der eigenen Arbeit beschäftigen, den Bestand dominieren, hat die Selbstreflexion einen sehr hohen Stellenwert gehabt, wodurch die eigentliche Arbeit vernachlässigt wurde. In den Beurteilungen der Veranstaltung stand die Reflexion über ideologische Erfolge im Vordergrund. Es wurde beraten, auf welchen Gebieten sich die Arbeit des Zentralhauses und die Zusammenarbeit mit Massenorganisationen und Volkskunstgruppen verbessern ließe. Diese Reflexion wurde zumeist in Form von Debatten mit den Mitarbeitern des Zentralhauses betrieben, die Stärken und Schwächen wurden ausgiebig diskutiert. Die Themen der Debatten führten immer wieder auf die gleichen Punkte zurück: Wie kann die sozialistische Überzeugung der Volkskünstler gefestigt werden? Wie kann die künstlerische Qualität erhöht werden? Über diese beiden Fragen finden sich immer wieder sehr ähnlich strukturierte Debatten. Sie muten beinahe philosophisch an, da diese Fragen nicht mit einer pragmatischen Lösung zu klären sind. Es kann nicht über einen Lösungsvorschlag abgestimmt und dieser zu den Akten gelegt werden. Diese Debatten wirken durch ihre Häufigkeit und die Ähnlichkeit des Verlaufs beinahe wie ein Ritual, dessen Ausgang jeder kennt, das aber trotzdem immer wieder vollzogen werden muss. Dr. Nedo erstellte zur Selbstbetrachtung des Zentralhauses 1960 einen Entwurf: „1. Das Zentralhaus erschreckt durch Maßlosigkeit der Aufgabenstellung- es gibt nichts womit sich Zentralhaus für Volkskunst nicht beschäftigen müsse, so müsse die Arbeit hinter Anforderungen zurückbleiben 2. Der Charakter des Zentralhauses für die Volkskunst bleibt ungeklärt. Ist es die Dienststelle des Ministeriums für Kultur (vermutlich nicht, denn es hat keine Weisungsbefugnis), ist eine es eine nachgeordnete Institution (wenn ja, muss geklärt werden, mit welchen spezifischen Aufgaben im Rahmen der staatlichen Organisationen usw.) Die Unterstellung unter das Ministerium für Kultur ist unkonkret und unpräzise (wer im Ministerium für Kultur ist zuständig für Anleitung des Zentralhauses für Volkskunst?) 3. Das Zentralhaus für Volkskunst wird die Verantwortung aufgebürdet, aber Massenorganisationen sind Träger des Volkskunstschaffens, über das Verhältnis zwischen dem Zentralhaus für Volkskunst, dem Ministerium für Kultur und den Organisationen fehlen konkrete Angaben. Es muss noch die Teilung der Aufgaben erfolgen 4. Weitere Führungsorgane wie Klubs, Kulturzentren müssen berücksichtigt werden 5. Aus dem Institut für Volkskunstforschung wird nun die Abteilung des Zentralhauses für Volkskunst, demnach aus Beiordnung Unterordnung- aufgrund der verschiedenen Aufgaben und Charaktere ist dies nicht tragbar“[132] Die Fragen, die Dr. Nedo hier aufwarf, wurden so oder ganz ähnlich schon sehr oft diskutiert. Dennoch sind sie nicht endgültig geklärt worden. Die Suche nach einer eigenen Definition noch acht Jahre nach der Gründung ist symptomatisch für die Arbeit des Zentralhauses. Eine wichtige Maßnahme, um die Bürger der DDR zur Angepasstheit zu erziehen, war die Selbstkritik. An ihr wurde auch im Zentralhaus für Laien-/Volkskunst nicht gespart. Hier wurden vor allem Schwachpunkte in der Organisation benannt. Im Abschlussbericht zum „Fest des Deutschen Volkstanzes“ vom 24.-26.6.1955 in Rudolstadt fielen kritische Bemerkungen zur eigenen Arbeit. „Im Gegensatz zu der künstlerischen und ideologischen Vorbereitung des Festes unter den Tanzgruppen in der DDR setzten die organisatorischen Vorbereitungen zur Durchführung des „Festes des Deutschen Volkstanzes“ zu spät ein. […]Auch unter den Genossen der SED-Kreisleitung Rudolstadt war man sich einen Monat vor Beginn des Festes noch nicht vollauf über die Fülle der zu bewältigenden Aufgaben eines solchen Org.-Büros im klaren, so dass die Parteiaufträge, die die Rudolstädter Genossen zu Mitarbeit im Org[anisations]-Komitee verpflichten sollten, teilweise erst sehr spät und nicht immer klar umrissen, gegeben wurden. Dieser Mangel wurde später durch die SED-Kreisleitung beseitigt. […]“[133] Selbstkritik galt in der DDR als geschätztes Mittel, seine Verbundenheit mit dem Staat kundzutun und durch die Anerkennung der eigenen Schuld das System zu entlasten. Hermann Glasern bezeichnet dieses Verhalten als „sublimen Masochismus, ein rätselhaftes Mentalitätsmuster für sowjethörige Kommunisten.“[134] Wenn die vorhandenen Schwächen auf Fehler von einzelnen Mitarbeitern zurückzuführen wären, dann musste man die Probleme nicht als Unstimmigkeiten im politischen System betrachten. Auf diesem Wege wurden unliebsame Mitarbeiter aus ihren Positionen gedrängt und das Zentralhaus wusch sich von Fehlentscheidungen rein. Die Selbstanalysen, verbunden mit der Selbstkritik, zogen sich durch den gesamten untersuchten Zeitraum. Eine Analyse des Zentralhauses von 1960 über die eigene Arbeit besagt: „Es gab ungenügende Arbeit durch mangelnde kollektive Beratung im Zentralhaus für Volkskunst, ungenügende politische Qualifikation der Mitarbeiter, zu wenig Personal, die Tätigkeitsmerkmale waren nicht in Übereinstimmung mit der Realität.“[135] Die Betrachtung der Arbeit des Zentralhauses und ihrer kontinuierlichen Probleme wirft die Frage auf, ob die fehlende Übereinstimmung mit der Realität tatsächlich an der mangelnden Beratung, der ungenügenden politischen Qualifikation und dem Mangel an Personal lag. Vielmehr scheinen die utopische Vorstellung der Tätigkeitsbereiche des Zentralhauses und die überhöhten Ansprüche an dasselbige dazu zu führen, dass sich Realität und Anspruch nicht decken konnten. Durch die Selbstkritik der Mitarbeiter des Zentralhauses und das Anprangern von persönlichen Schwächen Einzelner blieb ein generelles Hinterfragen der Arbeitsweise aus und man konnte sich beruhigt von einer systemkritischen Betrachtung abwenden. Es wurde aber nicht nur getadelt. Das Zentralhaus sparte auch an Lob nicht. Häufig wurden die „beachtlichen Fortschritte“ hervorgehoben. Diese Lobeshymnen galten der Motivation der Mitarbeiter, aber auch der Motivation der Volkskünstler. Sie sollten zu noch größeren Leistungen angespornt werden. Im Statut des Zentralhauses für Volkskunst, welches nicht datiert ist, aber aufgrund der Namensgebung zwischen 1955 und 1962 entstanden sein muss, lässt sich die Hervorhebung der eigenen Unabdingbarkeit finden: „Die Regierung der DDR widmet ihre Fürsorge der ständigen Weiterentwicklung des künstlerischen Schaffens unserer Werktätigen. Die Gründung des Zentralhauses für Volkskunst, der Bezirkshäuser für Volkskunst und der Aufbau der Volkskabinette als Zentren der Anleitung sind dafür sichtbarer Ausdruck. Dieser Weg der Volkskunst unter der Arbeiter- und Bauermacht ist einmalig in Deutschland und übt eine große, anziehende Kraft auf die Volkskunstschaffenden in Westdeutschland aus.“[136] Lob verstärkte den Glauben an die eigenen Fähigkeiten und den eigenen Einfluss. Diese Einschätzung wiederum spornte dann zu verbesserten Leistungen an. Das Prinzip von Kritik und Lob im regelmäßigen Wechsel, schon aus Bismarcks Zeiten als „Zuckerbrot und Peitsche“ bekannt, war auch im Zentralhaus für Volkskunst eine wirkungsvolle Methode, um die Volkskünstler unter Kontrolle zu halten. Anspruch und Realität Es klang in den vorangegangen Kapiteln schon an: Die Ansprüche und die tatsächliche Wirkung des Zentralhauses waren nicht deckungsgleich. Letztendlich lässt sich über die Wirkung, die das Zentralhaus hatte, keine zuverlässige Aussage treffen, da diese in den Dokumenten des Zentralhauses nicht objektiv erfasst werden kann. Obwohl die Dokumente des Zentralhauses ein Selbstbild zeichnen und dadurch oftmals anzuzweifeln sind, kann man dennoch daraus teilweise die Wirkung des Zentralhauses abschätzen. Es steht außer Zweifel, dass sich die Bevölkerung nur bedingt von den Vorgaben der Funktionäre auf dem kulturpolitischen Feld beeinflussen ließ. Trotz Aussonderungen von „Schund- und Schmutzliteratur“ in Leihbibliotheken blieben „seichte“ Bücher gefragt. Der Bedarf an Unterhaltung herrschte weiterhin vor. Darüber hinaus entstand ein Schwarzmarkt für westliche Trivialliteratur.[137] Die Forderungen nach Anspruch und die gewünschte Abkehr von der Unterhaltung wurden von der Mehrheit der Bevölkerung nicht beachtet. Dieser Widerstand sagt zwar nichts über die organisierte Laienkunst des Zentralhauses aus, soll aber die punktuelle Eigenständigkeit der Bevölkerung auf dem kulturellen Feld verdeutlichen. Die Forderungen der Parteiführung wurden zum Teil einfach umgangen. Dieses Phänomen trat auch in der organisierten Laienkunst auf. Es wurden öffentliche Rügen darüber erteilt, dass der kleinbürgerliche Vergnügungsbetrieb eine fortschrittliche Kulturarbeit verdränge. Diese öffentlichen Rügen weisen darauf hin, „dass das wirkliche Leben in der Kulturarbeit Regie führte.“[138] Die Ansprüche der Führung überforderten die Fähigkeiten der Arbeiter. Die Autorität des Staatsapparats reichte nicht so weit, wie dieser es sich wünschte. Es lässt sich aus den vorhandenen Unterlagen nichts darüber aussagen, wie groß die Anzahl der Laienkunstgruppen war, die vom Zentralhaus geführt wurden. Die Gruppen, die unabhängig und verborgen vom Zentralhaus agierten, waren nicht in der Öffentlichkeit präsent und ihre Anzahl ist dadurch nicht erfassbar. Die Tatsache, dass es sie aber zweifelsfrei gab, weist auf den beschränkten Einfluss des Zentralhauses hin. Das Zentralhaus versuchte die Volkskünstler zu lenken, indem es nur opportune Agitatoren in die Öffentlichkeit ließ und durch die Teilnahme an Veranstaltungen und mit Preisen belohnte. Auch Drucklizenzen und Papierzuteilung gab es nur mit Zustimmung des Zentralhauses. Wer allerdings nicht um solche Anerkennung kämpfte, den konnte das Zentralhaus nicht erreichen und steuern. Solche Künstler wurden nicht öffentlich gefördert. Allerdings gab es auch keine strafrechtlichen Konsequenzen, wenn man in seinem Wohnzimmer formalistische Laienkunst betrieb. Es gab zwar seit 1954 eine Meldepflicht für Volkskunstgruppen, die dann dem Zentralhaus unterstellt waren, aber letztendlich war die Verfolgung und Kontrolle nicht gemeldeter Künstler, die Kunst nur privat betrieben, auch für den „Überwachungsstaat DDR“ zu aufwändig.[139] Nicht alle Volkskunstgruppen wollten sich den Vorgaben unterwerfen und führten lieber eine Existenz ohne Aussicht auf Unterstützung und öffentliche Auftrittsmöglichkeiten, nur um das Zentralhaus umgehen zu können. Der Einfluss des Zentralhauses stieß aber auch innerhalb des von ihm offiziell angeleiteten Raumes auf Grenzen. Wenn man sich die Forderungen des Zentralhauses an die Volkskunstgruppen betrachtet, ist es wenig verwunderlich, dass nicht alle davon durchzusetzen waren. Auf den Seminaren wurde folgendes Bild des Sozialismus verbreitet: „In der ersten Stufe des Sozialismus gibt es noch Klassen: die Arbeiterklasse und die der werktätigen Bauern aber sind befreundet und haben gemeinsame Interessen.“[140] Dies ist eine Haltung, deren Naivität erstaunt. Es ist unrealistisch zu glauben, die Freundschaft zwischen zwei Bevölkerungsgruppen durch ein politisches System festlegen zu können. Diese Aussage in einem Seminar als Fakt zu vermitteln, ist polemisch. Es ist nicht verwunderlich, dass der Anspruch und die Realität bei solchen Vorstellungen nicht vereinbar waren. Das Wort „Freundschaft“ suggeriert eine emotionale Bindung, die nicht durch den Sozialismus erzwungen werden kann. Der bemühte Kampf um mehr Engagement und emotionale Bindung zeigt sich besonders gut an der Arbeit mit der Jugend und der Arbeit mit der Bevölkerung auf dem Lande. Bezüglich dieser Bereiche gibt es viele Berichte über Stagnation und Unzufriedenheit seitens des Zentralhauses. Hindernisse bei der Arbeit mit der FDJ Die Arbeit mit der FDJ wird immer wieder als Schwerpunkt in die Jahrespläne und Quartalspläne aufgenommen. Ebenso ist dies ein häufig protokolliertes Thema in den Diskussionen. Auf diesem Gebiet scheint es Komplikationen gegeben zu haben. Während die Arbeiter in großen Teilen der Bevölkerung dem Aufruf zur Produktion der Kunst nachkamen, wurde zu geringe Anteilnahme der Jugend und der ländlichen Bevölkerung bemängelt. Die Zahl der Gründungen von Zirkeln lag in diesen Bereichen unter dem Landesdurchschnitt. Es wurden viele Strategien ausgearbeitet, um die Beteiligung dort zu erhöhen. Besonders die Ausbildung von Führungspersönlichkeiten stellte ein großes Problem dar. Es gab auf dem Land nicht genügend qualifizierte Ausbilder, die Lehrgänge durchführen konnten. Es wurden zahlreiche Überlegungen angestellt, wie man den Anreiz für die Arbeit auf dem Lande erhöhen könne. Zum einen wollte man die Ausbildungsmöglichkeiten dort verbessern, um Kader für die eigenen Reihen zu erschließen, zum anderen versuchte man, qualifizierte Leiter der städtischen Gebiete für die kulturelle Arbeit auf dem Lande zu begeistern und dort hin zu versetzen. Die Vorgaben in der Zusammenarbeit mit der FDJ kamen vom Zentralkomitee. Das ZK verpflichtete alle Parteiorganisationen, sich in der Führung der FDJ auf folgende fünf Hauptaufgaben zu konzentrieren: „1. Die Erziehung der Jugend im Geiste eines echten Patriotismus 2. Das gründliche Studium und die Aneignung der fortschrittlichen Wissenschaft und Technik 3. Die allseitige körperliche Ertüchtigung der Jugend zur Erhöhung ihrer Gesundheit und ihrer Verteidigungsbereitschaft 4. Die Einbeziehung der ganzen Masse der Jugend in ein reiches kulturvolles und interessantes Jugendleben 5. Die politische und organisatorische Festigung des Verbandes der FDJ, der Entwicklung des innerverbandlichen Lebens mit Hilfe der Entfaltung der Kritik und Selbstkritik“[141] Dies galt als Maxime für die Arbeit des Zentralhauses. Jedoch war es schwierig diese Werte zu vermitteln, da die Jugend sich nicht sehr für die Zusammenarbeit mit dem Zentralhaus interessierte. So gab es von einigen Abteilungen Klagen „über unzureichende Verwaltung und Organisation der Massenorganisationen, besonders des FDGB und des FDJ. Durch mangelnde Propaganda des Wettbewerbs sind die Teilnehmerzahlen begrenzt gewesen.“[142] Die Verantwortung für das geringe Interesse wurde also nicht nur beim Zentralhaus, sondern auch bei den Massenorganisationen gesucht. Die Arbeit auf dem Lande Besonders schwer scheint die Arbeit auf dem Lande gewesen zu sein. Die Landbevölkerung, hauptsächlich aus Bauern bestehend, war nicht leicht für die Volkskunst zu begeistern. In ihrem bäuerlichen Dasein spielte Kunst keine große Rolle. Es war aber unentbehrlich, die Bauern an die Volkskunst heranzuführen. Man hätte auf die künstlerischen Produkte der Bauern verzichten können, nicht aber auf deren Angliederung an das System und den Einfluss, den man durch die Volkskunst gewann. Darüber hinaus war die Kadersituation in den ländlichen Gegenden schwierig. Das Land war kein Anziehungspunkt für die Kunst. Knotenpunkt für künstlerische Entwicklung war die Großstadt. Auch für Kader des Zentralhauses war ein Posten auf dem Land wenig reizvoll. Um die Situation zu verbessern, wurden eigens Konferenzen einberufen. In diesen bemängelte man die geringe Anzahl der Gruppen und forderte mehr Überblick über die Entwicklung der Jugend. Es sollten Anknüpfungspunkte für jeden Sektor der Volkskunst auf dem Lande geschaffen werden. Für diese wurden Betätigungen vorgeschlagen, die mit der dortigen Bevölkerung am ehesten in Verbindung gebracht wurde. So wurde versucht, die Bauern an handwerkliche Kunst wie Fassadenmalerei, bemalte Schränke und Truhen, Schnitzereien, Drechselarbeiten und Webereien heranzuführen. Um die Entwicklung auf dem Land voranzutreiben, sollte jeder Mitarbeiter eine Patenschaft über einen ländlichen Zirkel übernehmen.[143] Es bestand aber grundsätzlich das Problem, die Landbevölkerung vom Sinn der Volkskunst zu überzeugen und sie in diese Mentalität einzuführen. Hier gab es auch Enttäuschungen für das Zentralhaus. Nicht alle ländlichen Volkskünstler betrieben die Volkskunst aus der „richtigen“ Motivation, darüber wussten die Mitarbeiter bei einer Diskussion der Abteilung Bildende Kunst 1956 zu berichten: „Heinze: „Bisher wurde immer angenommen, dass im Erzgebirge wirklich nur am Feierabend die Kumpels schnitzen, und nun hören wir, dass sie es nur tun, um Profit zu machen. Das ist eine Enttäuschung.“[…] Janietz: „Wir machen doch nicht Volkskunst um der Volkskunst wegen: Die Hauptaufgabe ist doch die Erziehung der Werktätigen mit der Volkskunst.“ […] Thibault: „Es ist doch sehr schwer die Zirkel umzuerziehen und gegen Individualismus zu kämpfen. Hier muss eine große Veränderung vor sich gehen.“[144] Bei dieser Diskussion, die aus der Hilflosigkeit gegenüber der Landbevölkerung resultiert, wird noch einmal klar, wie sehr die Volkskunst als Erziehungsinstrument gesehen wurde. Gerade deswegen war es so wichtig, dass sie bei allen Bevölkerungsschichten Zulauf fand. Es wurden etliche Maßnahmen beschlossen, um die Situation auf dem Land zu verbessern: „Auf allen Landesgütern und Maschinen-Ausleihstationen sind Kulturräume einzurichten. Bei den notwendigen Schulneubauten auf dem Lande sind entsprechende Kulturräume für die Jugend und die Dorfbevölkerung vorzusehen. Bei seiner kulturellen Arbeit muß sich der Lehrer vor allem auf die VdgB und die FDJ stützten, die ihrerseits der Kulturarbeit im Dorf die größte Aufmerksamkeit widmen müssen. […] Von besonderer Bedeutung ist die Verbesserung der künstlerischen Arbeit im Dorf, an der nicht nur Schriftsteller und Musiker, sondern die vor allem durch den Ausbau der ländlichen Volkskunstgruppen gefördert werden muß. Dorfbüchereien sind in allen größeren Dörfern einzurichten. Wo dazu keine Möglichkeiten bestehen, sind Kreisbüchereien zu Versorgung der Dörfer zu schaffen. In den Kulturräumen sind regelmäßige Lesestunden, Selbstbildungsmaterial und Vorträge zu organisieren. […] In die Dörfer unserer Republik ist die fortschrittliche Kultur eingezogen. Durch die Einrichtung von Dorfbibliotheken und die ständige Erweiterung des Landfilmdienstes sind wichtige Voraussetzungen zu Einbeziehung der Landbevölkerung in das kulturelle Leben geschaffen worden. Das Theater kommt ins Dorf und fördert die Liebe der Landbevölkerung zur Kultur. Dorfensembles, Kultur- und Tanzgruppen, Chöre und Zirkel pflegen das Kulturerbe unserer Nation. 252 Kulturhäuser und 1944 Bauernstuben wurden errichtet.“[145] Obwohl hier konkrete Pläne gefasst und umgesetzt wurden, verbesserte sich die Aktivität in der Bevölkerung nicht. Eine große Anzahl von Kulturhäusern und Bauernstuben garantieren noch kein Interesse von Seiten der Menschen. Da die Diskussion über die Verbesserung der Arbeit auf dem Land in den folgenden Jahren unvermindert weiterging, kann man daraus schließen, dass sich die Situation nicht verändert hatte. Gerade dieses Beispiel demonstriert eindrucksvoll, wie frappierend die Realität und der Anspruch des Zentralhauses auseinander gingen. Die Sprache und die Propaganda des Zentralhauses veränderten sich nicht. Die Mitarbeiter des Zentralhauses standen auch Jahre später noch den gleichen Problemen gegenüber. Auch wenn das Zentralhaus die Stagnation nicht selbst benennt, kann man sie aus den gleich bleibenden Problemen und Lösungsansätzen schließen. Programmatische Gründe für die Namensänderungen des Zentralhauses Das „Zentralhaus für Laienkunst“ wurde 1952 unter diesem Namen gegründet und führte ihn bis 1955. Zu diesem Zeitpunkt wurde es in „Zentralhaus für Volkskunst“ umbenannt. Auch dies sollte nicht der endgültige Name bleiben. Im Jahr 1962 bekam es den Namen „Zentralhaus für Kulturarbeit“, den es dann bis zu seinem Ende 1989/90 behielt. In den Dokumenten wird die Umbenennung nie ausdrücklich thematisiert. Es gibt aber Äußerungen zu den Begrifflichkeiten „Laienkunst“ und „Volkskunst“. Schon 1950 unterschied Otto Grotewohl bei der Akademie der Künste diese beiden Formen: „Eine wichtige Aufgabe ist die Weiterentwicklung der Laienkunst. Ich vermeide extra den Begriff Volkskunst, denn Volkskunst soll alle Kunst sein.“[146]Damit schloss Grotewohl die Berufskunst in die Volkskunst ein. Wenn man diese Definition zugrunde legt, weitet sich das Aufgabenfeld des Zentralhauses im Jahre 1955 also auch auf die Betreuung der Berufskünstler aus. Die Volkskunst schloss jede Form der Kunst ein und unterschied nicht zwischen Laien- und Berufskunst. In diese Richtung ging man durch den „Bitterfelder Weg“ noch weiter. Dr. Paul Nedo, dessen Aussage zu den verschiedenen Aussagen nur grob nach 1954 datiert werden kann, fasste den Begriff Volkskunst schon etwas allgemeiner: „Wir verstehen darunter [Volkskunst] künstlerisches Schaffen des werktätigen Volkes in der antagonistischen Klassengesellschaft der Vergangenheit, also Schaffen der Arbeiter, Bauern und Handwerker im Gegensatz zur Kunst der herrschenden Klasse“[147] Nedos Definition des Begriffs „Volkskunst“ wich insofern von Grotewohls Erklärung ab, als dass für ihn Volkskunst die Kunst des werktätigen Volkes ist. Er schloss hier die Berufskunst nicht explizit aus, implizierte aber, dass Volkskunst durch Arbeiter und Bauern vollbracht wird, da diese das Volk repräsentieren, während die Berufskünstler und Intellektuellen nicht als Volkskünstler gelten. Wenn man Nedos Aussage stärker gewichtet, veränderte sich also nicht der Aufgabenbereich des Zentralhauses, sondern nur die Definition des Begriffs. Dies scheint aber nicht so gewesen zu sein, da die Tendenz durchaus in die Richtung der Arbeit mit Berufskünstlern ging. Die Vermutung liegt nahe, dass das Zentralhaus dies mit einer Umbenennung signalisieren wollte. Außerdem würde diese Verbreiterung des Bedeutungsfeldes seines Titels in die Stringenz der späteren Namensänderung passen. Der Name des Zentralhauses wurde mit den Jahren immer weiter gefasst. Diese Tendenz zur Verallgemeinerung zeigt sich ebenso am folgenden Beispiel von 1957: „Der Begriff „Volksmusik“ muss in der DDR geklärt werden. Eine Reihe von Personen versteht darunter das Spielen von Volksmusikinstrumenten unter Verwendung folkloristischer Literatur. Man sollte von der Trennung der Begriffe Volksmusik und Kunstmusik abgehen und das Musizieren unseres Volkes in seiner vielfältigen Weise, egal, ob sie auf einem sog. Volksinstrument durchgeführt wird oder auf einem sog. Kunstinstrument und unabhängig davon, ob auf diesem Instrumenten folkloristische Musik oder sog. Kunstmusik dargeboten wird, als Volksmusik bezeichnen.[…]“[148] Die verschiedenen Aussagen weisen auf die ungeklärte Definition der Begriffe „Laienkunst“ und „Volkskunst“ hin. Es wurde über die Differenzierung der beiden Begriffe gesprochen, aber letztendlich gab es keine offizielle Haltung, die von den Kulturfunktionären geschlossen vertreten worden wäre. Dementsprechend gab es auch in der Bevölkerung keine Klarheit über die Unterscheidung der Begrifflichkeiten. Der Folklorist B.N. Putilow benutzte die beiden Begriffe in seiner Abhandlung gleichbedeutend, ohne die geringste Differenzierung erkennen zu lassen.[149] Daran ist ersichtlich, dass es keine gängige Haltung zu dieser Problematik gab. Die 1955 in Kraft getretene Namensänderung in Zentralhaus für Volkskunst wird für den Großteil der Bevölkerung wenig Bedeutung gehabt haben. Es mag sein, dass sich die Parteiführung eine programmatische Botschaft gewünscht hat. Diese ist aber nicht deutlich genug in die Reihen der Volkskünstler getragen worden, da die Begriffe Volkskunst und Laienkunst von der Bevölkerung gleichbedeutend benutzt wurden. Die zweite Umbenennung fasste den Titel des Zentralhauses noch weiter. Während sowohl Volks-, als auch Laienkunst darauf verweisen, dass es sich, zumindest nicht ausschließlich, um Berufskunst handelt, lässt das Wort „Kulturarbeit“ keine Rückschlüsse zu. Kulturarbeit kann prinzipiell alles sein. Der Begriff „Kultur“ ist bis heute abstrakt und schlecht zu greifen. Er wird von jedem Betrachter verschieden konnotiert. 1961 war der Kulturbegriff vom Zentralhaus weit gefasst. Als Kultur galten alle Gebiete der menschlichen Produktion und Reproduktion.[150] Hier nach genaueren Definitionen zu suchen, würde vom Thema wegführen. Es soll nur auf die zunehmende Abstrahierung und Verallgemeinerung der Betitelung des Zentralhauses hingewiesen werden. Wie schon erwähnt, fand die zweite Unbenennung des Zentralhauses 1962 statt. Die einzige Erläuterung, die zur Umbenennung erfolgte, findet sich in einem Protokoll über die Arbeitstagung der Bezirksarbeitsgemeinschaft Blasmusik Karl-Marx-Stadt am 3.und 4. Februar 1962: „[…] Die Umbenennung des „Zentralhaus für Volkskunst“ in „Zentralhaus für Kulturarbeit“ spiegelte diese Weiterentwicklung wider, indem damit auch eine höhere Aufgabenstellung und neue Qualität verbunden war.“[151] Was allerdings diese „höhere Aufgabenstellung“ ist, bleibt ungeklärt. Es wurden keine zusätzlichen Aufgabenbereiche genannt, die künftig vom Zentralhaus für Kulturarbeit zu bearbeiten sind. Auch die „Weiterentwicklung“ wurde nicht anhand von Beispielen verdeutlicht und bleibt dadurch fraglich. Warum Kulturarbeit eine höhere Qualität als Volkskunst schaffen soll, wurde ebenso wenig erläutert. Wie so oft lässt sich hier das Bedürfnis nach Verbesserung der Arbeit feststellen, ohne ein Konzept für eine solche zu haben. Es wurde das Vorhaben postuliert, mit der Namensänderung höhere Qualität zu produzieren. Wie dies umgesetzt werden soll, wurde nicht erläutert. Es mangelte dem Zentralhaus nicht an Ambitionen, aber an der Fähigkeit diese umzusetzen. Wie so oft ist Ungenauigkeit in der Formulierung als ein Grundproblem zu ersehen. Wende in der Kulturpolitik Ende der Fünfziger Jahre Gegen Ende der Fünfziger Jahre veränderte sich das Klima in der DDR. Die Wirtschaft im Arbeiter- und Bauernstaat hatte sich nicht wie gewünscht entwickelt. Durch stärkere Verknüpfung zwischen Wirtschaft, Politik und Kunst sollte mittels des „Bitterfelder Wegs“ ein Aufschwung eingeleitet werden. Außerdem sollte die Volkskunst attraktiver gestaltet werden, was eine Liberalisierung in einigen Punkten mit sich brachte. Mit diesen Veränderungen in der Kulturpolitik und der Umsetzung im Zentralhaus wird sich der letzte Teil der Arbeit beschäftigen. Der Bitterfelder Weg. Ein neuer Gedanke für das Zentralhaus? Die Bitterfelder Konferenz bekam viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und wurde als große Erneuerung begriffen. Nach Betrachtung des Konzepts in den Jahren zuvor muss festgestellt werden: So neu war der Gedanke der Verknüpfung von Laienkunst und Berufskunst nicht. Die Volkskunst wurde, wie man anhand des Zentralhauses sehen kann, seit Beginn der DDR und auch schon zu Zeiten der SBZ gefördert und in den Vordergrund des künstlerischen Schaffens gestellt. Durch die Proklamation des „Bitterfelder Wegs“ und die Präsenz Walter Ulbrichts bei den Konferenzen wurde das Konzept dank griffiger Parolen populär. Den innovativen Charakter, der propagiert wurde, hatte es jedoch nicht. Das Zentralhaus vertrat schon seit seiner Gründung die Stärkung der Kunstschaffenden aus den Arbeiterreihen und die Zusammenarbeit mit den Berufskünstlern. Es hatte nicht solch plakative Parolen wie „Greif zur Feder, Kumpel, die deutsche Nationalkultur braucht Dich!“, aber inhaltlich stand der „Bitterfelder Weg“ in der Tradition der Arbeit des Zentralhauses. 1955 entstand ein Briefwechsel zwischen dem Zentralhaus und dem 3. Kongress des Verbandes Bildender Künstler Deutschlands in Berlin. In diesem war Folgendes zu lesen: „Die Volkskunst ist auch für Berufskünstler ein Born neuer Erkenntnisse, Anregungen, schöpferischer Impulse. Es muss eine Zusammenarbeit aller schöpferischen Kräfte geben.“[152] Das Zentralhaus war stets an der Zusammenarbeit zwischen Berufs- und Laienkünstlern interessiert. Als dieser Plan plötzlich solch einen Aufwind bekam und von der obersten Instanz in den Mittelpunkt des Interesses gerückt wurde, war das Zentralhaus mit dem Ansturm der Volkskünstler überfordert. 1959 bekam diese Bewegung eine solche Dynamik, dass die Verwaltung des Zentralhauses sich enorm verändern musste. Überall luden Klubhäuser zum Mit- und Selbermachen ein und neue Zirkel entstanden. Im Zuge einer Auswertung der Bitterfelder Konferenz wurden die Pläne und Maßnahmen des Zentralhauses für Volkskunst beurteilt. Dieses Dokument ist leider nicht datiert, es kann aber angenommen werden, dass es Ende der Fünfziger Jahre entstand. Dort wird angegeben, dass „das Zentralhaus nicht den Stand für das gegenwärtige System der Aus- und Weiterbildung für Volksschaffende hat und nicht die Höhe der Forderungen der Bitterfelder Konferenz erfüllt.“[153] Die Anforderungen an das Zentralhaus änderten sich nicht durch den „Bitterfelder Weg“, die Anzahl der Teilnehmer stieg aber rapide an. „Es zeigt sich ein schnelles, freilich zunächst nur quantitatives Wachstum der Bewegung schreibender Arbeiter nach der 1. Bitterfelder Konferenz. […] dass man die Zahl der Zirkelgründungen in den Jahren 59-62 (vorsichtig genug!) pro Bezirk mit 20-25 veranschlagt, ergibt sich, dass in den ersten Jahren nach der Bitterfelder Konferenz 300-400 Zirkel schreibender Arbeiter gebildet wurden. […]“[154] Der „Bitterfelder Weg“ wurde positiv aufgenommen und ermunterte viele Arbeiter, sich einer Form der Volkskunst zuzuwenden. Das Zentralhaus zeigte sich anfänglich mit den neuen Begebenheiten überfordert. Hier lässt sich erkennen, dass das Konzept des „Bitterfelder Weges“ von den Initiatoren selbst unterschätzt wurde und sie nicht auf den Ansturm der Bürger, die an der Schaffung der Volkskunst teilnehmen wollten, vorbereitet waren. Dies mag nicht zuletzt daran liegen, dass der Grundgedanke des „Bitterfelder Weges“ kein neuer war. Die Ziele des „Bitterfelder Weges“ wurden schon vorher sehr viel langsamer und mit weniger Beteiligung verfolgt. Mit dem plötzlichen Erfolg des alten Konzepts war im Zentralhaus nicht gerechnet worden. Der „Bitterfelder Weg“ musste von ganz oben initiiert werden, da das Zentralhaus alleine nicht öffentlichkeitswirksam genug war. Die Bemühungen, die Volkskunst derart populär zu machen, bestanden immer, ohne die Hilfe von Ulbricht gelang dies jedoch nicht. An dieser Stelle ist erneut auf die fehlerhafte Organisation des Zentralhause zu verweisen. Nicht die Erschaffung des Gedankens, sondern der Aufwand, mit dem das Konzept verbreitet, gefördert und propagiert wurde, führte zu der plötzlichen Begeisterung in der Bevölkerung. Mit dem Ansturm auf die Einrichtungen der Volkskunst im Jahre 1959 hatte das Zentralhaus nicht gerechnet und mit der Organisation war es überfordert. Laut Werner Mittenzwei bildeten sich 18.000 Volkskunstgruppen und 133 Theater. Der Staat wendete enorme finanzielle Mittel auf, um die Bewegung zu unterstützen.[155] In der Zeit nach den Bitterfelder Konferenzen entstanden unzählige Brigadetagebücher und Anthologien, von denen einige beim Zentralhaus aufbewahrt wurden und heute im Archiv der Akademie der Künste einzusehen sind. Neues Aufgabenfeld des Zentralhauses: Die Arbeiterfestspiele Eine bedeutende Veränderung, die der „Bitterfelder Weg“ für das Zentralhaus mit sich brachte, war die Einführung der Arbeiterfestspiele. Hier tat sich ein großer Bereich auf, der in seiner Vorbereitung und Organisation beinahe alle Kapazitäten des Zentralhauses in Anspruch nahm. Die Arbeiterfestspiele waren die größte Veranstaltung der Volkskunst, die bis dahin stattgefunden hatte. Erstmals fanden sie 1959 statt. „Die 1. Arbeiterfestspiele der DDR fanden auf Initiative des Bundesvorstandes des FDGB, […] zwei Monate nach der 1. Bitterfelder Konferenz […] statt. […]Bestimmend für die Vorbereitung und Durchführung der 1. AFS waren die Beschlüsse des V. Parteitages der SED, und damit die Losung Jetzt muss die Arbeiterklasse die Höhen der Kultur erstürmen und von ihnen Besitz ergreifen a. Statistische Angaben b. Festspielzentren: Halle Merseburg, Bitterfeld, Eisleben und Dessau c. Zahl der Veranstaltungen: 287 d. Zahl der Besucher: 625 000 e. Zahl der Mitwirkenden: 6 400 Laienkünstler 4 900 Berufskünstler f. Bedeutende Aufführungen und Veranstaltungen: Schriftstellerforum, Verlagstag der Tribüne, Brecht-Abend, Literaturabend des Zirkels der Laienautoren der Neptunwerft Rostock Theateraufführungen, Filmveranstaltungen, Konzerte, Ausstellungen, Volkskunstensembles und Arbeitervarieté, ausländische Solisten und Ensemble.“[156] Für die folgenden Jahre gab es eben solche statistischen Angaben. Die zweiten Arbeiterfestspiele waren noch besser besucht als die ersten. Alle festgehaltenen Größen hatten sich in dem einen Jahr erhöht. Die 2. Arbeiterfestspiele Vom 4.-12.Juni 1960 in Karl-Marx Stadt Statistische Angaben b. Zahl der Veranstaltungen: 1 200 c. Zahl der Besucher: 1 200 000 d. Zahl der Mitwirkenden: 25 000 Laienkünstler und 5 000 Berufskünstler[157] Die Zahl der Veranstaltungen hatte sich beinahe verfünffacht, die Zahl der Besucher immerhin fast verdoppelt. Während sich die Zahl der Laienkünstler beinahe vervierfacht hatte, stieg die Zahl der teilnehmenden Berufskünstler nur um 100 an, was einen Anstieg von 2 % bedeutet. Das Konzept wurde im ersten Jahr von den Berufskünstlern laut Statistik des Zentralhauses nicht so gut angenommen wie vom Rest der Bevölkerung. 1961 gab es in der Statistik schon unterschiedliche Tendenzen: Die 3. Arbeiterfestspiele 10.-18. Juni 61 in Magdeburg b. Zahl der Veranstaltungen: 1431, geplant waren 8000 c. Zahl der Besucher:1 295 000 d. Zahl der Mitwirkenden: 20 000 Laienkünstler und 5 000 Berufskünstler[158] Während die Veranstaltungen zwar im Vergleich zum Vorjahr noch etwas anstiegen, blieben sie doch weit hinter den Erwartungen zurück. Auch die Zahl der Besucher hatte noch eine leicht steigende Tendenz, ließ sich aber mit dem Anstieg vom Jahr davor nicht vergleichen. Die Teilnahme der Volkskünstler hatte sogar einen Rückgang zu verzeichnen. Hieran zeigt sich, dass die Arbeiterfestspiele schon im dritten Jahr nicht mehr die eindeutig positive Tendenz hatten. Diese Entwicklung sollte sich bei den vierten Arbeiterfestspielen noch verstärken: Die 4. Arbeiterfestspiele In Erfurt, Weimar, Gotha, Eisenach, Nordhausen, Worbis b. Zahl der Veranstaltungen: 250 c. Zahl der Besucher: 850 000d. Zahl der Mitwirkenden: 5000 Laienkünstler und 3000 Berufskünstler[159] Die vierten Arbeiterfestspiele verzeichneten bei allen Werten einen rasanten Einsturz. Die anfängliche Euphorie ließ nach, das Interesse der Werktätigen nahm ab. Nur noch ein Sechstel der Veranstaltungen des Vorjahres fanden statt. Diese Zahl ist geringer als bei den ersten Arbeiterfestspielen. Die Zahl der Besucher sank fast um die Hälfte. Die Zahl der Laienkünstler reduzierte sich um ein Viertel, die der Berufskünstler um ein gutes Drittel. Im Jahr 1962 war die Tendenz nicht mehr zu leugnen: Alle Zahlen sind weiterhin rückläufig, zum Teil dramatisch. Die Arbeiterfestspiele verloren an Ansehen und Popularität. Sie blieben zwar weiterhin ein Forum für Volksschaffende und die Ausrufung des „Bitterfelder Wegs“ veränderte die Landschaft des Volksschaffens dauerhaft, konnte aber die anfängliche Euphorie nicht in diesem Maße halten. An solchen Zahlen eine eindeutige Entwicklung festzumachen, ist brisant, weil sich in Veröffentlichungen der FDJ gegenteilige Behauptungen finden lassen. Dort wird behauptet, dass die Arbeiterfestspiele den beständigen Fortschritt der Volkskunst repräsentierten, da immer mehr Werktätige daran teilnähmen.[160] So wurden die Fakten verdreht oder geleugnet, um für die Öffentlichkeit ein positives Bild zu zeichnen. Das Sinken der Teilnehmerzahlen darf jedoch nicht als finales Scheitern betrachtet werden. Die Volkskunst blieb ein bedeutendes Thema, und viele der gegründeten Zirkel blieben erhalten. Laienkunst in der DDR wurde weiterhin als hohes Gut gehandelt und wäre ohne den „Bitterfelder Weg“ sicher nicht zu einer solchen Breitenwirkung gekommen. Dennoch hielt die anfängliche überschwängliche Begeisterung nicht an. Ab 1972 fanden die Arbeiterfestspiele nur noch alle zwei Jahre statt. Die Arbeiterfestspiele wurden vom Zentralhaus entworfen, vorbereitet und ausgewertet. Ebenso trafen die Mitarbeiter dort die Auswahl der Teilnehmer. Die Teilnehmer wurden nach ideologischen Kriterien ausgesucht. „Kollege Hohl“ beurteilte die ersten Arbeiterfestspiele am 20.7.1959. In seiner Schlussfolgerung schrieb er: „Wir dürfen doch nicht um eine Vielzahl von Veranstaltern betteln müssen. Es muss im Gegenteil eine Ehre sein, dafür ausgewählt zu werden. […] Die Vorbereitung der nächsten Festspiele muss so beginnen, dass den in Aussicht genommenen Gruppen diese inhaltliche (politische) Vorarbeit zur Pflicht gemacht wird.“[161] Das Zentralhaus belegte die Arbeiterfestspiele mit dem erzieherischen Charakter, der schon so oft zu entdecken war. Nur wer bereit war, sich den Ansprüchen des Zentralhauses zu unterwerfen, durfte teilnehmen und wurde in die Gemeinschaft der Volkskunstschaffenden aufgenommen. Nicht das Zentralhaus mit seinen Veranstaltungen sollte um Teilnehmer kämpfen, sondern die Teilnehmer um die Erlaubnis, dabei sein zu dürfen. Das Zentralhaus musste immer in der Position bleiben, die Spielregeln bestimmen zu können. Es durfte sich nicht auf Kompromisse einlassen. Insofern war es wichtig, immer Überlegenheit zu demonstrieren. Walter Ulbricht verband mit der kulturellen Veränderung, die er durch die Arbeiterfestspiele repräsentiert sah, auch einen Wandel im familiären Sozialverhalten. In seiner Rede vom 11.6.1961 sagte er: „[…] Früher wurde in der Freizeit gesoffen, der Mann ging in die Kneipe und die Frau saß zu Hause oder der Mann ging Skatspielen – man sagt, das soll sogar heute noch vorkommen – aber ich denke im Allgemeinen haben wir jetzt schon eine solche Lage, dass doch die Menschen, der Mann mit der Frau und den Kindern ins Theater gehen und der Mann die Frau nicht alleine sitzen lässt, dass sich im Zusammenhang mit den Brigaden der schreibenden Arbeit die Gemeinschaftsarbeit nicht nur in der Produktion entwickelt hat, sondern dass sie auch eine große kulturelle Arbeit leisten.[…] Jetzt sind wir dabei, so zu arbeiten, dass die Arbeiterklasse eine höhere Kultur bekommt als die alte Bourgeoisie, die bei uns zum Teufel gejagt wurden. […] Die Arbeiterfestspiele spiegeln den Fortschritt wider, den wir erreicht haben, den wir erkennen, der uns aber noch nicht ausreicht.“ [162] Die Volkskunst und die damit verbundenen Arbeiterfestspiele machten laut Ulbricht also nicht nur bessere Künstler, Staatsbürger und Sozialisten aus den Teilnehmern, sondern auch bessere Ehemänner und Familienväter. Diese Erwartung übte im Rückschluss erhöhten Druck aus. Wer ein vorbildliches Familienoberhaupt sein wollte, musste an den Arbeiterfestspielen teilnehmen. Um eine Genehmigung zur Teilnahme zu bekommen, musste man den Anforderungen des Zentralhauses entsprechen. Der Einfluss auf alle Volkskünstler, die nicht isoliert sein, sondern der offiziellen Gemeinschaft der Volkskünstler angehören wollten, musste dem ideologischen Leitbild des Zentralhauses folgen. Das Zentralhaus gab die Richtlinien für die Arbeit der Jury heraus und führte Seminare mit den Jurymitgliedern durch. Es erstellte auch die Teilnahme- und Auszeichnungsurkunden. Darüber hinaus war das Zentralhaus für die Verbreitung der Plakate im Vorfeld verantwortlich.[163] Die Arbeiterfestspiele vergrößerten den Aufgabenbereich des Zentralhauses und verlagerten den Schwerpunkt der Arbeit auf dieses Gebiet. Die konkrete Aufgabenstellung der Organisation der Arbeiterfestspiele erhöhte die Effizienz des Zentralhauses. Wirtschaft als zentraler Aspekt in der Kulturpolitik Schon seit Gründung der DDR wurde die Kulturpolitik als Teil der Staatspolitik verstanden.[164] Die Teilgebiete des Staates wie Politik, Wirtschaft und Kultur wurden ganzheitlich gesehen. Ziel war es, sie dem Volk als Einheit begreiflich zu machen. Wie in dem vorangegangenen Kapitel schon anklang, wurde die Wirtschaft gegen Ende der Fünfziger Jahre stärker thematisiert. Der „Bitterfelder Weg“ kann durchaus auch als Teilgebiet des neuen Wirtschaftskurses begriffen werden. Durch stärkere Bindung von Politik, Wirtschaft und Kultur sollte die Bevölkerung ein ausgeprägtes wirtschaftliches Bewusstsein entwickeln. Dies sollte zu mehr Engagement auch auf diesem Gebiet und somit zum Aufschwung führen. In der Auswertung der Volkskunstgruppen zu Ehren des V. Parteitages der SED am 25.11.1958 ist zu lesen: „[…] Die Bestrebungen zur Steigerung des Arbeitsergebnisses dürfen nicht mehr nur allein das Anliegen der betreffenden Betriebe bleiben, sondern müssen auch zum Anliegen der Volkskunst des Bezirkes werden. Aus diesem Grund nehmen wir bewusst Anteil und erklären uns bereit, aktiv an der Erfüllung der wirtschaftlichen Aufgaben mitzuarbeiten.“[165] Die Wirtschaft lief nicht ohne Komplikationen und wurde deshalb zunehmend thematisiert. Die DDR musste auf Sparkurs gehen und das auf allen Gebieten. Der Beschluss des Zentralkomitees vom 12.7.1957 sagte aus: „[…] Die Anwendung strengster Sparsamkeit ist ständiges Prinzip der Arbeit. Es ist ein ständiger Kampf gegen die unproduktiven und unnützen Ausgaben zu führen. Insbesondere kommt es auf die richtige Anwendung des Prinzips der wirtschaftlichen Rechnungsführung, der wirtschaftlich-operativen Selbstständigkeit der Betriebe, der materiellen Interessiertheit der Arbeiter, Angestellten und der Vertreter der technischen Intelligenz sowie der Bezahlung der Arbeit nach Leistung an.“[166] In den Dokumenten des Zentralhauses der frühen Fünfziger Jahre spielte die Wirtschaft kaum eine Rolle. Allein die Kulturpolitik wurde in den Berichten und Protokollen besprochen. Seit Mitte der Fünfziger Jahre vollzog sich ein Wandel. Immer häufiger wurden wirtschaftliche Überlegungen in die Projekte des Zentralhauses miteinbezogen. Die kulturellen Veranstaltungen sollten die Wirtschaft unterstützen. Wettbewerbe sollten diese Haltung verbreiten. „Die erste Staatsaufgabe ist die Erfüllung des Kohle- und Energieprogrammes unserer Regierung. Wir rufen daher nochmals alle Betriebsfilmstudios zur Beteiligung an dem vom Bundesvorstand des FDGB ausgeschriebenen Wettbewerb auf.“[167] Dieser Aufruf erschien 1958 und zeigt die Verbindung zwischen Wirtschaft und Wettbewerb. Während vorher vor allem Politik in der Kultur thematisiert werden sollte, geriet nun die Wirtschaft in den Fokus. Die Volkskunst sollte der Wirtschaft als Zugpferd dienen und für deren Zwecke instrumentalisiert werden, so wie vorher schon auf politischer Ebene. Die hier aufgeführten Beispiele ließen sich noch vermehren. Da sie inhaltlich aber ähnlich sind, wird darauf verzichtet.[168] Erwähnt sei noch die Ansprache, die Walter Ulbricht 1960 zu der gegenseitigen Befruchtung von Wirtschaft und Kultur hielt.„Wie die Erfüllung unseres Volkswirtschaftsplanes auf allen Sphären der Kultur wirkt und immer bessere Voraussetzungen dafür schafft, die wachsenden kulturellen Bedürfnisse aller Werktätigen zu befriedigen, so wirkt sich umgekehrt die Bereicherung unseres kulturellen Lebens befruchtend und belebend auf die produktive Tätigkeit unserer Menschen aus.“[169] Ulbricht betonte die Wechselseitigkeit des Verhältnisses zwischen Kultur und Wirtschaft. Er führte aus, dass die Wirtschaft der Nährboden für die Kultur sei und umgekehrt die Kultur die Wirtschaft belebe. Dies impliziert, dass die Kulturschaffenden sich durch eine verbesserte Wirtschaft, für die sie sorgen sollten, auch eine bessere Basis für die Kulturarbeit schaffen würden. Das Zentralhaus rückte diese Aspekte in seinen Veranstaltungen in den Vordergrund. Die Erziehung breitete sich vom sozialistischen zum ökonomischen Menschen aus. Das Zentralhaus sollte noch eine Funktion mehr berücksichtigen und in den Alltag einbauen. Fazit Die ersten zehn Jahre des Bestehens des Zentralhauses für Laien-/Volkskunst waren als eine zu Phase sehen, die von großen Schwierigkeiten geprägt war. Das Zentralhaus sollte die „progressive sozialistische Volkskunst“ anführen, stagnierte aber aus verschiedenen Gründen. Es hatte sich große Ziele gesetzt. Über den Zugang der Kunst sollten die Menschen zu Sozialisten erzogen werden. Dies war die Prämisse für das gesamte Handeln des Zentralhauses. Menschen sollte Kunst nahe gebracht werden, die in der Vergangenheit weder primäre Produzenten noch Rezipienten der Kultur waren: die Arbeiter und Bauern. Es galt, den Adressaten zu erreichen und ihn die gewünschte sozialistische Haltung zu lehren oder diese in ihm zu stärken. Das Zentralhaus hatte eine doppelte Zielsetzung. Die erhoffte Symbiose aus künstlerischer Meisterschaft der Arbeiter gepaart mit sozialistischer Überzeugung, die durch die Kunst transportiert wird, erwies sich als langwieriges Unterfangen. Das Zentralhaus stieß dabei aus verschiedenen Gründen an Grenzen. Ein Grund für die mangelnde Effizienz ist in strukturellen Schwächen zu finden. Das Zentralhaus war mit dem Feld „Aufbau der Laienkunst“ betraut, ohne dass es ein Konzept dafür gegeben hätte. Der Aufgabenbereich war dementsprechend weit gefächert und unübersichtlich. In den folgenden Jahren zeigte sich, dass das Zentralhaus sich seines Zuständigkeitsgebietes nicht gewahr war und nicht organisiert arbeitete. Die erst 1958 erfolgte Fixierung eines Statuts ist repräsentativ für die Methode „trial and error“, die erst aufgrund von praktischen Erfahrungen und entsprechenden Fehlern ein Konzept entwirft. Diese Haltung hat das Zentralhaus jahrelang in seiner Wirkungsweise aufgehalten. So beschäftigte es sich mit der Organisation von Veranstaltungen, obwohl das laut Statut nicht zu seinen Aufgaben gehörte. Die stetige Wiederkehr der gleichen Diskussionen und Problemen zeigt die Schwäche des Zentralhauses, sie zu beheben. Hinzu kam der Spagat zwischen künstlerischen und inhaltlichen Anforderungen. Das Zentralhaus profilierte sich durch seine Kompetenzen auf künstlerischem Gebiet. Die Kunst diente letztlich aber lediglich als Schlüssel zur politischen Beeinflussung der Bevölkerung und wurde instrumentalisiert um die Arbeiter an den Sozialismus zu binden. Die Arbeiter wurden zu einer positiven und produktiven Darstellung des Sozialismus getrieben, da ihre Kunst ansonsten nicht vom Staat gefördert wurde. Das Zentralhaus schuf mit seiner Arbeit einen Widerspruch in sich. Es verhinderte durch Vorgaben, dass sich die Kunst frei entfalten konnte. Es setzte Grenzen auf einem Gebiet, das davon lebt, Grenzen zu überschreiten und somit innovative Kunst zu schaffen. Die staatliche Kontrolle des Zentralhauses hemmte damit Kreativität und verhinderte die Weiterentwicklung der Kunst. Andererseits benötigt Kunst staatliche Förderung, um sich frei von wirtschaftlichen Zwängen zu entfalten. Das Zentralhaus schuf viele Plattformen, um die bis dato kulturell unterprivilegierte Schicht in dieses System einzubinden. Es erzielte damit beachtliche Erfolge. Allerdings war der Einfluss des Zentralhauses auf die Laienkünstler begrenzt. Da Laienkünstler nicht existentiell durch „Berufsverbot“ zu bedrohen waren, konnte das Zentralhaus ihnen gegenüber nicht die gleichen Repressalien anwenden wie bei Intellektuellen. Allerdings stellten vereinzelt abweichende Laienkünstler aufgrund der mangelnden Öffentlichkeit keine so große Gefahr dar. Letztendlich waren die Repressalien nicht der entscheidende Faktor in der Arbeit des Zentralhauses. Vielmehr sollte die Laienkunst als attraktiv dargestellt werden. Der große Aufwand, der zur Einbindung der Arbeiter durch das Zentralhaus betrieben wurde, vermittelte den Eindruck, dass Kultur in der DDR auf höchster Ebene gehandelt wurde und diese besonders humanistisch sei. Die Tatsache, dass die Arbeiter vom Zentralhaus in den Mittelpunkt des Interesses gerückt wurden, vermittelte diesen den Eindruck, in dem neuen System ernst genommen und geschätzt zu werden. Darüber hinaus konnte von wirtschaftlichen Schwächen abgelenkt werden. Der Erfolg der Einbindung in die Kulturarbeit war besonders wichtig, da die Bevölkerung sich mit der Massenkultur beschäftigen und sich nicht kritisch mit der Politik und Wirtschaft auseinandersetzten sollte. Die Form der Auseinandersetzung mit diesen Themen wurde in der Laienkultur staatlich kontrolliert und gelenkt. Eben diese Aufgabe erfüllte das Zentralhaus für Laien-/Volkskunst, obgleich es damit nicht die Kontrolle über die gesamte Alltagskultur erreichte. Man kann nicht verhehlen, dass die Idee des Zentralhauses, durch Kultur Menschen zu formen, plausibel erscheint. Dennoch war die Form der Umsetzung nicht besonders effizient und die Mittel oftmals manipulativ, was die Legitimität des Instituts schmälert. In den ersten zehn Jahren ist nur eine geringe Entwicklung des Durchsetzungsvermögens aus eigener Kraft zu beobachten. Die Entwicklung, die das Zentralhaus zu verzeichnen hatte, ist zu einem großen Teil der Propaganda des „Bitterfelder Wegs“ und der Ausrichtung der „Arbeiterfestspiele“ geschuldet. Das Zentralhaus fand mehr Beachtung und wurde mit dieser Veranstaltung landesweit assoziiert. Es ist auch ein Zusammenhang zwischen der Liberalisierung gegen Ende der Fünfziger Jahre und der damit einhergehenden geringfügigen Abkehr von strengster Ideologiekontrolle und der zunehmenden Konzentration auf praktische Aufgaben, wie das Ausrichten der Arbeitfestspiele, herzustellen. Diese Entwicklung führte dazu, dass das Zentralhaus die Entfaltung der Künstler gegen Ende der Fünfziger Jahre nicht mehr so stark einschränkte wie in den ersten Jahren nach seiner Gründung. Anhang Organigramm der Hierarchie der Institute 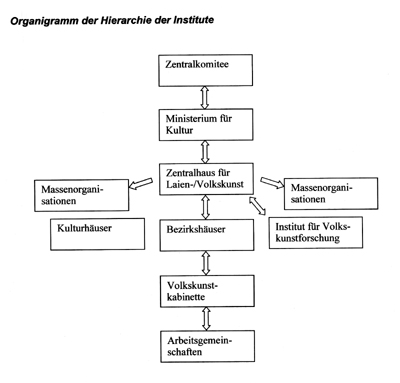 Abkürzungsverzeichnis AdK --- Akademie der Künste BDV --- Bund Deutscher Volksbühnen BRD --- Bundesrepublik Deutschland BStU --- Bundesbeauftragte für die Unterlagen der Staatssicherheit der DDR DFD --- Demokratischer Frauenbund Deutschlands DDR --- Deutsche Demokratische Republik DSF --- Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft FDGB --- Freier Deutscher Gewerkschaftsbund FDJ --- Freie Deutsche Jugend IM --- Inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit MfS --- Ministerium für Staatssicherheit SED --- Sozialistische Einheitspartei Deutschland SBZ --- Sowjetisch besetzte Zone SMAD --- Sowjetische Militäradministration in Deutschland SU --- Sowjetunion VdgB --- Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe VDV --- Verband Deutscher Volkskunstschaffender ZfK --- Zentralhaus für Kulturarbeit ZfV --- Zentralhaus für Volkskunst Bibliografie Quellen Akademie der Künste, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 1. Tagesordnungen und Sitzungsvorlagen 19523 Vorlagen für Leitungssitzungen 1955. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 3. Vorlagen für Leitungssitzungen 1955. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 4. Vorlagen für Leitungssitzungen 19575 Leitungssitzungsprotokolle und Vorlagen 1958-1959. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 5. Leitungssitzungsprotokolle und Vorlagen 1958-1959. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 7. Sitzungsprotokolle 1961. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 8. Sitzungsprotokolle 1962. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 46. Leitungssitzungsprotokolle und Vorlagen 1956. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 47. Struktur- und Stellenpläne 1951-1968. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 67. Statut des Zentralhauses für Kulturarbeit und der Bezirkshäuser für Volkskunst 1954-1962. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 73. Protokoll der Tagung der ZAG 22.-23.Juni 1962. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 85. Arbeitskonferenz des Zentralhauses für Laienkunst-Fachseminar der Abt. Chor/Ensemble Musik 3.-4. März 1954. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 95. Konferenz der Laienschaffenden der DDR (Enth.: Protokoll und die für den Druck vorgesehene Fassung, Entschließung) 23.-25.Nov 1962. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 108. Beratung des Leistungskollektivs des ZfV 18.-21. Dez. 1956. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 111. Volkskunstkonferenz (Enth.: Referat von Prof. H. Koch und Vorbereitungsmaterial ) 15. Juni 1957. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 163. Arbeitspläne, Berichte, Konzeptionen der AG Puppentheater 1958-1977. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 209. Dokumente der Kulturpolitik der SED 1946-1957. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 213. Woche der Volkskunst anlässlich des 10. Jahrestages der DDR (Ent.: Vorbereitung und Durchführung) 28. Sep – 4. Okt 1959. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 214 Theoretische Arbeiten zum Thema Volkskunst 1952-1958. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 215. Unterlagen über die Arbeit des Berliner Volkskunstkabinetts (Berliner Haus der Volkskunst) 1953-1969. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 216. Entwicklung des Instituts für Volkskunstforschung von seiner Gründung bis zur Neufestlegung der Richtlinien (Enth. auch: Entwicklung der Volkskunstarbeit auf dem Lande 1953-1955) 1956-1961. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 218. Entwicklung der Volkskunstbewegung in der DDR (Enth. auch: Dokumentation zur Arbeit der gewerkschaftlich geleiteten Kulturhäuser 1945-1988) 1958-1974. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 233. Aufgaben und Probleme des Volkskunstschaffens (Enth. auch: Bericht aus den Bezirken) 1960-1961-Volksschaffens aus beiden Teilen Deutschlands am 11.01.1958) 1958-1959. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 240. Volkskunstwettbewerb 1961/1962 „Singt das Lied des Sozialismus“ (Enth.: Aufruf und Bedingung) 1961-1962. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 228. Entwicklung auf dem Gebiet der Volkskunst (Enth. auch: Materialien zur Entwicklung des Begriffs Volkskunst) 1949-1954. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 229. Kaderanalyse des Zentralhauses für Volkskunst 1955. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 230. Entwicklung des künstlerischen Volksschaffens (Enth. u.a.: Analyse der Arbeit der BZH für VK, Materialsammlung „Kleine Form“ des künstlerischen Volksschaffens. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 231. (Enth. auch: Volkskunstaufgebot 1958) Volkskunstinitiativen 1956-1958. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 232. Förderung der Volkskunst in der DDR - Ordnung über die Verleihung „Preis für künstlerisches Volksschaffen“ (Enth. auch: Empfang anlässlich der Zusammenkunft von Freunden des künstlerischen. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 240. Volkskunstwettbewerb 1961/1962 „Singt das Lied des Sozialismus“ (Enth.: Aufruf und Bedingung) 1961-1962. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 243. Deutsche Festspiele der Volkskunst (Enth.: Teilnahmebögen aus dem Bezirk Neubrandenburg) 1952. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 245. Deutsche Festspiele der Volkskunst (Enth.: Wettbewerbe) 1952. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 276. Sozialistisches Volkskunstaufgebot 1958/1959 1958 (Enth. v.a.: Bewerbungsrichtlinien, Berichte, Aktionspläne). AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 277. Sozialistisches Volkskunstaufgebot 1958/1959 (Enth. v.a.: Berichte und Verpflichtungen). AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 278. Sozialistisches Volkskunstaufgebot (Enth.: Berichte aus den Bezirken Erfurt und Frankfurt/O.). AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 279. „“ (Enth.: Berichte aus den Bezirken Halle und Magdeburg). AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 280. „“(Enth.: Aufruf, Verpflichtungen, Brief Walter Ulbricht, Gesamteinschätzung). AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 281. „“ (Enth.: Verpflichtungserklärungen aus dem Bezirk Gera). AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 282. „“(Enth.: Verpflichtungen aus dem Bezirk Dresden). AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 283. „“ (Enth.: Verpflichtungen aus den Kreis-Volkskunstkabinetten). AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 284. „“(Enth.: Berichte aus den Bezirken Berlin und Cottbus). AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 285. „“ (Enth.: Berichte aus dem Bezirk Dresden). AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 286. „“ (Enth.: Berichte aus dem Bezirk Neubrandenburg). AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 287. „“ (Enth.: Berichte aus den Bezirken Potsdam, Rostock, Schwerin und Suhl). AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 288-289. „“ (Enth.: Auswertung des Volkskunstaufgebotes). AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 313. Chronik des künstlerischen Volksschaffens 1945-1974 – Arbeitsunterlagen zur Erforschung der Geschichte des künstlerischen Volksschaffens 1945-1989. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 349. Weltfestspiele der Jugend und Studenten (Enth.: Programme von 1951) 1951-1959. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 363. II. Fest des Deutschen Volkstanzes (Enth.: Abschlußbericht) 24.-26.Jun. 1955. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 399. ZAG Blasmusik 1961-1989. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 402. Arbeit der Bezirksarbeitsgemeinschaften 1962-1988. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 411. Konferenz der Lehrer für Gesellschaftstanz (Enth.: Begrüßung und Diskussionsbeitrage) 29.-30. Sep. 1958. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 414. Konferenz der Laientanzmusiker (Enth.: Stenogr. Protokoll) 23.-25.März 1962. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 419. 2. Deutsche Volksmusiktage (Enth. v.a.: Berichte und Teilnehmerlisten) 19.-22. April 1957. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 429. Chronologie des künstlerischen Volksschaffen: Chor 1945-1966 (Enth. auch: Materialsammlung 1945-1990 1945-1990. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 430. Sitzungen des Chorausschusses der DDDR 1953-1972. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 437. Wartburgtreffen der Deutschen Sänger 1953-1958. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 488. Agitationsprogramme 1957-1962. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 503. Entwicklung verschiedener Chöre 1953-1989. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 508. 1. Arbeiterfestspiele der DDR 13.-21. Jun. 1959. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 513. 4. Arbeiterfestspiele der DDR 09.-11.06.1962 1961-1962. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 510-511. 3. Arbeiterfestspiele der DDR 10.-18.06.1961 (Bd.510 enth.: Vorbereitung und Durchführung Bd. 511 enth.: Fachgebiete Bildnerisches Volksschaffen, Film und Tanz) 1960-1961. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 538. Bezirksarbeitsgemeinschaft künstlerisches Wort (Enth.: Protokolle, Berichte) 1958-1962. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 546. Kongreß der Laientheater der DDR 15.-18. April 1960. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 559. Seminarpläne und Lehrbriefe 1952-1986. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 561. Zirkelmonographien (Enth. auch: „Wie werde ich als Leiter eines Volkskunstkollektivs gemeinsam mit dem Zirkel tätig“). AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 565-566. Entwicklungseinschätzungen und Perspektivpläne des bildnerischen Volksschaffens (Bd. 565 enth.. 1955-1978; Bd 566 enth.: 1981-1990) 1955-1990. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 557. Zusammenarbeit mit dem sozialistischen Ausland und der BRD 1952-1978. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 569. Ausstellungen der Bereiche Bildende Kunst und Einschätzungen derselben 1952-1988. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 599. Entwicklung der Kulturarbeit in den Klubs und Kulturhäusern 1958-1985. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 630. Elementarschulung auf dem Gebiet des künstlerischen Volksschaffens 1960-1961. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 644. Analyse der Bewegung schreibende Arbeiter 1958-1967. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 653. Struktureller Aufbau verschiedener Abteilungen 1950-1987. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 848. Kurze Einschätzung der 1.-7. und 10. Arbeiterfestspiele 1959-1986. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 884. Aus- und Weiterbildung, Arbeitsrichtlinien für Tanzlehrer (Enth. auch: Methodische Grundlagen) 1953-1981. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr.899. Entwicklung des Arbeiterlaientheaters (Enth. auch. Theaterstücke) 1957-1985. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 916. Schulung und Förderung der Chöre und der Chorleiter 1954 1987. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 919. Zusammenarbeit zwischen den deutschen Volkskunstgruppen und Organisation: Briefwechsel, Bericht 1952-1957. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 920-921. Zusammenarbeit zwischen Ost- und Westdeutschen Volkskunstgruppen und –Organisationen (Bd. 920 enth. auch. Jahreseinschätzung über die Entwicklung der Arbeit nach Westdeutschland 1958) 1959. AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 948. Materialsammlung, Rohmanuskript zur Geschichte des künstlerischen Volksschaffens in der DDR von Dr. R. Zimmermann (Teil 1 enth.: Kommunale Betreuung/Zentralstelle für Volkskunst/Staat; Teil 2 enth.: Volksbühne und Volkskunst) 1945-1952. Neues Deutschland. 28.11.1961. (Walter Ulbricht auf der 14. ZK – Tagung der SED) nach: Jäger, Manfred. Kultur und Politik in der DDR 1945-1990. Leipzig 1995. Sekundärliteratur Bruder Martinus. Bentzien. In: Wer war Wer in der DDR. Ein biographisches Handbuch. Hrsg.: Barth, Bernd-Rainer; Links, Christoph; Müller-Enbergs, Helmut; Wielgohs, Jan. Frankfurt am Main 1995. Dietrich, Gerd. Rolle und Entwicklung der Kultur. In: Deutsche Zeitgeschichte von 1945 bis 2000. Gesellschaft – Staat – Politik. Ein Handbuch. Hrsg.: Burrichter, Clemens; Nakath, Detlef; Stephan, Gerd-Rüdiger. Berlin 2006. Eckert, Rainer. Massenorganisationen. In: Lexikon des DDR-Sozialismus. Das Staats- und Gesellschaftssystem der Deutschen Demokratischen Republik. Hrsg.: Eppelmann, Rainer; Möller, Horst; Nooke, Günter; Wilms, Dorothee. Paderborn 1996. Eppelmann, Rainer. Lexikon des DDR-Sozialismus des Staats- und Gesellschaftssystems der DDR. Paderborn 1996. Fritzlar, Sigrid. Paul Nedo. In: Biographisches Handbuch der SBZ/DDR 1945-1990. Hrsg.: Baumgartner, Gabriele; Hebig, Dieter. München 1997. Glaser, Hermann. Deutsche Kultur 1945-2000 Bonn 1997. Groschopp, Horst. Kulturhäuser in der DDR. Vorläufer, Konzepte, Gebrauch. Versuch einer historischen Rekonstruktion. In: Kulturhäuser in Brandenburg. Eine Bestandsaufnahme. Brandenburger Texte zu Kunst und Kultur. Hrsg.: Ruben, Thomas; Wagner, Bernd. Potsdam 1994. Groschopp, Horst: Breitenkultur in Ostdeutschland. Herkunft und Wende – wohin? In: Aus Politik und Zeitgeschichte (APZ), B11/2001. Jäger, Manfred. Kulturpolitik. In: Lexikon des DDR-Sozialismus. Das Staats- und Gesellschaftssystem der Deutschen Demokratischen Republik. Hrsg.: Eppelmann, Rainer; Möller, Horst; Nooke, Günter; Wilms, Dorothee. Paderborn 1996. Koch, Manfred. Parteien und Massenorganisationen im „sozialistischen Mehrparteiensystem“. In: Die DDR. Daten – Fakten – Analysen. Ploetz. Hrsg.: Fischer, Alexander. Mittenzwei, Werner. Die Intellektuellen Literatur und Politik in Ostdeutschland 1945-2000. Berlin 2003. Mortier, Jean. Kunst und Kultur. In: Deutsche Zeitgeschichte von 1945 bis 2000. Gesellschaft – Staat – Politik. Ein Handbuch. Hrsg.: Burrichter, Clemens; Nakath, Detlef; Stephan, Gerd-Rüdiger. Berlin 2006. Schenk, Fritz. Staats- und Verwaltungsapparat. In: Lexikon des DDR-Sozialismus. Das Staats- und Gesellschaftssystem der Deutschen Demokratischen Republik. Hrsg.: Eppelmann, Rainer; Möller, Horst; Nooke, Günter; Wilms, Dorothee. Paderborn 1996. Staritz, Dietrich. Geschichte der DDR. Erweiterte Neuausgabe. Frankfurt am Main 1996. Zentralrat der FDJ. [Hrsg.] Die Herausbildung der sozialistischen Persönlichkeit – eine Hauptaufgabe der Partei bei der Gestaltung der sozialistischen Gesellschaftsordnung. In: Dokumente zur Kultur und Kunstpolitik der SED 1971-1987. Berlin 1987. Endnoten [1] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 209. Dokumente der Kulturpolitik der SED 1946-1957. [2] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 209. Dokumente der Kulturpolitik der SED 1946-1957. [3] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 313. Chronik des künstlerischen Volksschaffens 1945-1974 – Arbeitsunterlagen zur Erforschung der Geschichte des künstlerischen Volksschaffens 1945-1989. [4] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 948. Materialsammlung, Rohmanuskript zur Geschichte des künstlerischen Volksschaffens in der DDR von Dr. R. Zimmermann (Teil 1 enthalt: Kommunale Betreuung/Zentralstelle für Volkskunst/Staat; Teil 2 enthält: Volksbühne und Volkskunst) 1945-1952. [5] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 288. Sozialistisches Volkskunstaufgebot (Enthält: Auswertung des Volkskunstaufgebotes). [6] Groschopp. Breitenkultur. S.20. [7] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 1. Tagesordnungen und Sitzungsvorlagen 1952. [8] Adk, Berlin Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 214. Theoretische Arbeiten zum Thema Volkskunst 1952-1958. [9] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 3. Vorlagen für Leitungssitzungen 1955. [10] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 3. Vorlagen für Leitungssitzungen 1955. [11] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 566. Entwicklungseinschätzungen und Perspektivpläne des bildnerischen Volksschaffens1981-1990. [12] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 429. Chronologie des künstlerischen Volksschaffen: Chor 1945-1966 (Enth. auch: Materialsammlung 1945-1990). [13] „Zirkel: staatlich zugelassene Interessengemeinschaften, die ohne Vereinstatus auskommen mussten, standen unter organisatorisch künstlich-fachlicher Anleitung, für die es spezielle Ausbildungen, Schulungen, Anleitungen und sogar Ausweise gab.“ Zitiert nach: Groschopp, Horst. Kulturhäuser in der DDR. Vorläufer, Konzepte, Gebrauch. Versuch einer historischen Rekonstruktion. In: Kulturhäuser in Brandenburg. Eine Bestandsaufnahme. Brandenburger Texte zu Kunst und Kultur. Hrsg.: Ruben, Thomas; Wagner, Bernd. Potsdam 1994. S. 105. [14] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 561. Zirkelmonographien (Enth. auch: „Wie werde ich als Leiter eines Volkskunstkollektivs gemeinsam mit dem Zirkel tätig“). [15] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 884. Aus- und Weiterbildung, Arbeitsrichtlinien für Tanzlehrer (Enth. auch: Methodische Grundlagen) 1953-1981. [16] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 46. Leitungssitzungsprotokolle und Vorlagen 1956. [17] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 3. Vorlagen für Leitungssitzungen 1955. [18] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 419. 2. Deutsche Volksmusiktage (Enth. vor allem: Berichte und Teilnehmerlisten) 19.-22. April 1957. [19] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr.108. Beratung des Leistungskollektivs des Zentralhaus für Volkskunst 18.-21. Dez. 1956. [20] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 209. Dokumente der Kulturpolitik der SED 1946-1957. [21] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 67. Statut des Zentralhaus für Kulturarbeit und der Bezirkshäuser für Volkskunst 1954-1962. [22] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 108. Beratung des Leistungskollektivs des ZfV 18.-21. Dez. 1956. [23] Ebenda. [24] Groschopp. Breitenkultur. S.20. [25] Koch, Manfred. Parteien und Massenorganisationen im „sozialistischen Mehrparteiensystem“. In: Die DDR. Daten – Fakten – Analysen. Ploetz. Hrsg.: Fischer, Alexander. S. 91ff. [26] Eckert, Rainer. Massenorganisationen. In: Lexikon des DDR-Sozialismus. Das Staats- und Gesellschaftssystem der Deutschen Demokratischen Republik. Hrsg.: Eppelmann, Rainer; Möller, Horst; Nooke, Günter; Wilms, Dorothee. Paderborn 1996. S. 405. [27] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 67. Statut des Zentralhauses für Kulturarbeit und der Bezirkshäuser für Volkskunst 1954-1962. [28] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 1. Tagesordnungen und Sitzungsvorlagen 1952. [29] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 209. Dokumente der Kulturpolitik der SED 1946-1957. [30] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 245. Deutsche Festspiele der Volkskunst (Enth.: Wettbewerbe) 1952. [31] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr.546. Kongreß der Laientheater der DDR 15.-18. April 1960. [32] Dietrich. Rolle und Entwicklung der Kultur. S.1012. [33] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 67. Statut des Zentralhaus für Kulturarbeit und der Bezirkshäuser für Volkskunst 1954-1962. [34] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 67. Statut des ZfK und der Bezirkshäuser für Volkskunst 1954-1962. [35] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr.233. Aufgaben und Probleme des Volkskunstschaffens (Enth. auch: Bericht aus den Bezirken) 1960-1961. [36] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 245. Deutsche Festspiele der Volkskunst (Enth.: Wettbewerbe) 1952. [37] Dietrich. Rolle und Entwicklung der Kultur. S.15. [38] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr.884. Aus- und Weiterbildung, Arbeitsrichtlinien für Tanzlehrer (Enth. auch: Methodische Grundlagen) 1953-1981. [39] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 85. Arbeitskonferenz des Zentralhauses für Laienkunst-Fachseminar der Abt. Chor/Ensemble Musik 3.-4. März 1954. [40] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 349. Weltfestspiele der Jugend und Studenten (Enth.: Programme von 1951) 1951-1959. [41] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 232. Förderung der Volkskunst in der DDR - Ordnung über die Verleihung „Preis für künstlerisches Volksschaffen“ (Enth. auch: Empfang anlässlich der Zusammenkunft von Freunden des künstlerischen Volksschaffens aus beiden Teilen Deutschlands am 11.01.1958) 1958-1959. [42] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 108. Beratung des Leistungskollektivs des ZfV 18.-21. Dez. 1956. [43] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 559. Seminarpläne und Lehrbriefe 1952-1986. [44] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 215. Unterlagen über die Arbeit des Berliner Volkskunstkabinetts (Berliner Haus der Volkskunst) 1953-1969. [45] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 230. Entwicklung des künstlerischen Volksschaffens (Enth. u.a.: Analyse der Arbeit der Bezirkshäuser für Volkskunst, Materialsammlung „Kleine Form“ des künstlerischen Volksschaffens. [46] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 231. (Enth. auch: Volkskunstaufgebot 1958) Volkskunstinitiativen 1956-1958. [47] Hain. Salons der Sozialisten. S.196. [48] Groschopp. Kulturhäuser in der DDR. S.101f. [49] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 218. Entwicklung der Volkskunstbewegung in der DDR (Enth. auch: Dokumentation zur Arbeit der gewerkschaftlich geleiteten Kulturhäuser 1945-1988) 1958-1974. [50] Hain. Salons der Sozialisten. S. 111. [51] Groschopp. Kulturhäuser in der DDR. S.110. [52] ebenda [53] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr.163. Arbeitspläne, Berichte, Konzeptionen der AG Puppentheater 1958-1977. [54] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 899. Entwicklung des Arbeiterlaientheaters (Enth. auch. Theaterstücke) 1957-1985. [55] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 538. Bezirksarbeitsgemeinschaft künstlerisches Wort (Enth.: Protokolle, Berichte) 1958-1962. [56] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr.214. Theoretische Arbeiten zum Thema Volkskunst 1952-1958. [57] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 216. Entwicklung des Instituts für Volkskunstforschung von seiner Gründung bis zur Neufestlegung der Richtlinien (Enth. auch: Entwicklung der Volkskunstarbeit auf dem Lande 1953-1955) 1956-1961. [58] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 3. Vorlagen für Leitungssitzungen 1955. [59] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 46. Leitungssitzungsprotokolle und Vorlagen 1956. [60] Fritzlar, Sigrid. Paul Nedo. In: Biographisches Handbuch der SBZ/DDR 1945-1990. Hrsg.: Baumgartner, Gabriele; Hebig, Dieter. München 1997. S.585. [61] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 46. Leitungssitzungsprotokolle und Vorlagen 1956. [62] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 216. Entwicklung des Instituts für Volkskunstforschung von seiner Gründung bis zur Neufestlegung der Richtlinien (Enth. auch: Entwicklung der Volkskunstarbeit auf dem Lande 1953-1955) 1956-1961. [63] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 216. Entwicklung des Instituts für Volkskunstforschung von seiner Gründung bis zur Neufestlegung der Richtlinien (Enth. auch: Entwicklung der Volkskunstarbeit auf dem Lande 1953-1955) 1956-1961. [64] ebenda [65] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 5. Leitungssitzungsprotokolle und Vorlagen 1958-1959. [66] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 559. Seminarpläne und Lehrbriefe 1952-1986. [67] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 630. Elementarschulung auf dem Gebiet des künstlerischen Volksschaffens 1960-1961. [68] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 67. Statut des Zentralhaus für Kultur und der Bezirkshäuser für Volkskunst 1954-1962. [69] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 85. Arbeitskonferenz des Zentralhauses für Laienkunst-Fachseminar der Abt. Chor/Ensemble Musik 3.-4. März 1954. [70] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 229. Kaderanalyse des Zentralhauses für Volkskunst 1955. [71] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 228. Entwicklung auf dem Gebiet der Volkskunst (Enth. auch: Materialien zur Entwicklung des Begriffs Volkskunst) 1949-1954. [72] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 67. Statut des Zentralhaus für Kulturarbeit und der Bezirkshäuser für Volkskunst 1954-1962. [73] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 313. Chronik des künstlerischen Volksschaffens 1945-1974 – Arbeitsunterlagen zur Erforschung der Geschichte des künstlerischen Volksschaffens 1945-1989. [74] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 4. Vorlagen für Leitungssitzungen 1957. [75] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 4. Vorlagen für Leitungssitzungen 1957. [76] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 4. Vorlagen für Leitungssitzungen 1957. [77] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 4. Vorlagen für Leitungssitzungen 1957 Protokoll 10/57 24.6.57. [78] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 7. Sitzungsprotokolle 1961 Protokoll 5/61 27.4.61. [79] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 569. Ausstellungen der Bereiche Bildende Kunst und Einschätzungen derselben 1952-1988. [80] Hain. Salons der Sozialisten. S.135ff. [81] Schenk, Fritz. Staats- und Verwaltungsapparat. DDR-Lexikon. S. 605. [82] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 488. Agitprop-Gruppenlieder mit Noten. [83] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 243. Deutsche Festspiele der Volkskunst (Enth.: Teilnahmebögen aus dem Bezirk Neubrandenburg) 1952. [84] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 653. Struktureller Aufbau verschiedener Abteilungen 1950-1987. [85] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 277-287. Sozialistisches Volkskunstaufgebot 1958/1959 (Enth. v.a.: Berichte und Verpflichtungen); Sozialistisches Volkskunstaufgebot (Enth.: Berichte aus den Bezirken Erfurt und Frankfurt/O.). [86] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 884. Aus- und Weiterbildung, Arbeitsrichtlinien für Tanzlehrer (Enth. auch: Methodische Grundlagen) 1953-1981. [87] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 8. Sitzungsprotokolle 1962: Propaganda, 15/62 vom 22.6.62. [88] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 7. Statut des ZfK und der Bezirkshäuser für Volkskunst 1954-1962. [89] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr.1. Tagesordnungen und Sitzungsvorlagen 1952. [90] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 288. Sozialistisches Volkskunstaufgebot (Enth.: Auswertung des Volkskunstaufgebotes). [91] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr.4. Vorlagen für Leitungssitzungen 1957. [92] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 8. Sitzungsprotokolle 1962. [93] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 599. Seminarpläne und Lehrbriefe 1952-1986. [94] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 93. Zentrale Tagung der Leiter der Volkskunstkabinette (Enth. v.a.: Teilnehmerlisten) 26.-27.Juni 1958. [95] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 213. Woche der Volkskunst anlässlich des 10. Jahrestages der DDR (Ent.: Vorbereitung und Durchführung) 28. Sep – 4. Okt 1959. [96] Mortier, Jean. Kunst und Kultur. In: Deutsche Zeitgeschichte von 1945 bis 2000. Gesellschaft – Staat – Politik. Ein Handbuch. Hrsg.: Burrichter, Clemens; Nakath, Detlef; Stephan, Gerd-Rüdiger. Berlin 2006. S.418. [97] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 948. Materialsammlung, Rohmanuskript zur Geschichte des künstlerischen Volksschaffens in der DDR von Dr. R. Zimmermann (Teil 1 enth.: Kommunale Betreuung/Zentralstelle für Volkskunst/Staat; Teil 2 enth.: Volksbühne und Volkskunst) 1945-1952. [98] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 245. Deutsche Festspiele der Volkskunst (Enth.: Wettbewerbe) 1952. [99] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 245. Deutsche Festspiele der Volkskunst (Enth.: Wettbewerbe) 1952. [100] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 919. Zusammenarbeit zwischen den deutschen Volkskunstgruppen und Organisation: Briefwechsel, Bericht 1952-1957. [101] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 85. Arbeitskonferenz des Zentralhauses für Laienkunst-Fachseminar der Abt. Chor/Ensemble Musik 3.-4. März 1954. [102] Dietrich. Rolle und Entwicklung der Kultur. S.1033. [103] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 46. Leitungssitzungsprotokolle und Vorlagen 1956. [104] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 46. Leitungssitzungsprotokolle und Vorlagen 1956. [105] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 916. Schulung und Förderung der Chöre und der Chorleiter 1954 1987: Protokoll über die Tagung des Chorausschusses der DDR für Volkskunst in Leipzig am 12.7.59. [106] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 557. Zusammenarbeit mit dem sozialistischen Ausland und der BRD 1952-1978. [107] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 921. Zusammenarbeit zwischen Ost- und Westdeutschen Volkskunstgruppen und –Organisationen (enth. auch. Jahreseinschätzung über die Entwicklung der Arbeit nach Westdeutschland 1958) 1959. [108] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 437. Wartburgtreffen der Deutschen Sänger 1953-1958. [109] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 430. Sitzungen des Chorausschusses der DDR 1953-1972. [110] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 503. Entwicklung verschiedener Chöre 1953-1989. [111] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 1. Tagesordnungen und Sitzungsvorlagen 1952. [112] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 209. Dokumente der Kulturpolitik der SED 1946-1957. [113] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 919. Zusammenarbeit zwischen den deutschen Volkskunstgruppen und Organisation: Briefwechsel, Bericht 1952-1957. [114] Staritz. DDR. S.70f. [115] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 209. Dokumente der Kulturpolitik der SED 1946-1957. [116] Hain. Salons der Sozialisten. S.108. [117] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 85. Arbeitskonferenz des Zentralhauses für Laienkunst-Fachseminar der Abt. Chor/Ensemble Musik 3.-4. März 1954. [118] ebenda [119] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 566. Entwicklungseinschätzungen und Perspektivpläne des bildnerischen Volksschaffens 1955-1990. [120] Dietrich. Rolle und Entwicklung der Kultur. S.1029. [121] Jäger, Manfred. Kulturpolitik. In: Lexikon des DDR-Sozialismus. Das Staats- und Gesellschaftssystem der Deutschen Demokratischen Republik. Hrsg.: Eppelmann, Rainer; Möller, Horst; Nooke, Günter; Wilms, Dorothee. Paderborn 1996. S.363. [122] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 1. Tagesordnungen und Sitzungsvorlagen 1952. [123] ebenda [124] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 414. Konferenz der Laientanzmusiker (Enth.: Stenographisches Protokoll) 23.-25.März 1962. [125] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 414. Konferenz der Laientanzmusiker vom 23.-25. März 1962 in Leipzig. [126] Neues Deutschland. 28.11.1961. (Walter Ulbricht auf der 14. ZK – Tagung der SED) nach: Jäger, Manfred. Kultur und Politik in der DDR 1945-1990. Leipzig 1995. S. 107. [127] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 3. Vorlagen für Leitungssitzungen 1955. [128] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 111. Volkskunstkonferenz (Enth.: Referat von Prof. H. Koch und Vorbereitungsmat.) 15. Juni 1957. [129] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 230. Entwicklung des künstlerischen Volksschaffens (Enth. u.a.: Analyse der Arbeit der BZH für VK, Materialsammlung „Kleine Form“ des künstlerischen Volksschaffens. [130] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 163. Arbeitspläne, Berichte, Konzeptionen der AG Puppentheater 1958-1977. [131] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 233. Aufgaben und Probleme des Volkskunstschaffens (Enth. auch: Bericht aus den Bezirken) 1960-1961. [132] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 67. Statut des ZfK und der Bezirkshäuser für Volkskunst 1954-1962. [133] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 363. II. Fest des Deutschen Volkstanzes (Enth.: Abschlußbericht) 24.-26.Jun. 1955. [134] Glaser. Deutsche Kultur. S.195. [135] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 47. Struktur- und Stellenpläne 1951-1968. [136] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 67. Statut des ZfK und der Bezirkshäuser für Volkskunst 1954-1962. [137] Mortier. Kunst und Kultur. S.425f. [138] Groschopp. Kulturhäuser in der DDR. S. 151. [139] Hain. Salons der Sozialisten. S.111. [140] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 559. Seminarpläne und Lehrbriefe 1952-1986. [141] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 209. Dokumente der Kulturpolitik der SED 1946-1957. [142] ebenda [143] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 3. Vorlagen für Leitungssitzungen 1955. [144] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 46. Leitungssitzungsprotokolle und Vorlagen 1956. [145] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 209. Dokumente der Kulturpolitik der SED 1946-1957. [146] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 948. Materialsammlung, Rohmanuskript zur Geschichte des künstlerischen Volksschaffens in der DDR von Dr. R. Zimmermann (Teil 1 enth.: Kommunale Betreuung/Zentralstelle für Volkskunst/Staat; Teil 2 enth.: Volksbühne und Volkskunst) 1945-1952. [147] ebenda [148] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 419. 2. Deutsche Volksmusiktage (Enth. v.a.: Berichte und Teilnehmerlisten) 19.-22. April 1957. [149] Vgl.: AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 71. Berichte und Erfahrungen von Städten und Gemeinden auf dem Gebiet der Kulturpolitik 1952-1968. [150] Hain. Salons der Sozialisten. S. 110. [151] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 402. Arbeit der Bezirksarbeitsgemeinschaften 1962-1988. [152] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 566. Entwicklungseinschätzungen und Perspektivpläne des bildnerischen Volksschaffens1955-1990. [153] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 653. Struktureller Aufbau verschiedener Abteilungen 1950-1987. [154] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 644. Analyse der Bewegung schreibende Arbeiter 1958-1967. [155] Mittenzwei, Werner. Die Intellektuellen Literatur und Politik in Ostdeutschland 1945-2000. Berlin 2003. S.166. [156] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 848. Kurze Einschätzung der 1.-7. und 10. Arbeiterfestspiele 1959-1986. [157] ebenda [158]ebenda [159] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 848. Kurze Einschätzung der 1.-7. und 10. Arbeiterfestspiele 1959-1986. [160] Die Herausbildung der sozialistischen Persönlichkeit – eine Hauptaufgabe der Partei bei der Gestaltung der sozialistischen Gesellschaftsordnung. In: Dokumente zur Kultur und Kunstpolitik der SED 1971-1987. Hrsg.: Zentralrat der FDJ. Berlin 1987. S. 21ff. [161] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 508. 1. Arbeiterfestspiele der DDR 13.-21. Jun. 1959. [162] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 510. 3. Arbeiterfestspiele der DDR 10.-18.06.1961 (enth.: Vorbereitung und Durchführung) 1960-1961. [163] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 240. Volkskunstwettbewerb 1961/1962 „Singt das Lied des Sozialismus“ (Enth.: Aufruf und Bedingung) 1961-1962. [164] Dietrich. Rolle und Entwicklung der Kultur. S.1002. [165] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 276. Sozialistisches Volkskunstaufgebot 1958/1959 1958 (Enth. v.a.: Bewerbungsrichtlinien, Berichte, Aktionspläne). [166] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 209. Dokumente der Kulturpolitik der SED 1946-1957. [167] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 5. Leitungssitzungsprotokolle und Vorlagen 1958-1959. [168] Vgl.: AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 288. Sozialistisches Volkskunstaufgebot (Enth.: Auswertung des Volkskunstaufgebotes). mit AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 508. 1. Arbeiterfestspiele der DDR 13.-21. Jun. 1959. [169] AdK, Berlin, Zentralhaus für Kulturarbeit, Nr. 233. Aufgaben und Probleme des Volkskunstschaffens (Enth. auch: Bericht aus den Bezirken) 1960-1961. | |